Bibliophile Notizen
Gerne informieren wir Sie hier von Zeit zu Zeit über Neuigkeiten und Aktivitäten
aus der Gemeinschaft der Bücherfreunde und -sammler.

«Endspurt» in Mainz: Drucker- und Verlagszeichen seit der Gutenberg-Ära
nur noch bis 22. Februar 2026
Ich drucke! Signet, Marke und Druckerzeichen
seit dem Zeitalter Gutenbergs
Sonderausstellung im Gutenberg-Museum
Reichsklarastraße 1, 55116 Mainz
Gutenberg selbst hatte noch keins – zum Leidwesen der Druckhistoriker:innen. Aber schon Johannes Fust und Peter Schöffer markierten ihre Publikationen mit einem Druckerzeichen. Diese kleinen Bild-Text-Kreationen waren weit mehr als bloße Markenzeichen, sondern ein Ausdruck von Identität, Bildung, Frömmigkeit, Witz und Unternehmenskultur.
Das Gutenberg-Museum bewahrt mit etwa 2000 Druckerzeichen einen bedeutenden Sammlungsschatz. Gustav Mori, Forscher und ausgebildeter Drucker, sammelte diese Stücke in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als lose Blattsammlung – eine damals weit verbreitete Praxis. Dieser Bestand wird erstmals präsentiert. Dabei setzt die Ausstellung die historischen Druckerzeichen sehr schön mit den heutigen Verlagslogos in Beziehung, denn ihre Bedeutung für Identität und Markenbildung ist bis heute relevant.
«Druckerzeichen sind ein Spiegel ihrer Zeit. Sie zeigen, wie Drucker:innen sich selbst darstellten, wie sie Vertrauen schufen und sich im Wettbewerb positionierten», so die Kuratorinnen Prof. Dr. Hui Luan Tran (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) und Dr. Nino Nanobashvili (Gutenberg-Museum Mainz). Sie «erzählen Geschichten über Identität und Marktverhältnisse, über Machtstrukturen, Religion und Bildung. Sie verbinden uns mit den Menschen, die hinter den Büchern stehen und die unsere Kultur geprägt haben.»
Zur Ausstellung ist im Deutschen Kunstverlag ein umfassender, sehr schön gestalteter Begleitband erschienen. Darin finden sich einleitende Beiträge zum Medium der Druckerzeichen und zur Sammlungsgeschichte des Gutenberg-Museums. Weitere Beiträge widmen sich der Rolle von Witwen als Druckerinnen, einer beeindruckenden Sammlung von Druckstöcken in Antwerpen, der Selbstpräsentation ukrainischer Drucker sowie der Entwicklung des Verlagslogos vom Deutschen Kunstverlag. Das Buch wird in der Frühjahrsausgabe der Wandelhalle für Bücherfreunde näher vorgestellt.
Blick in die Ausstellung. Foto © Silvia Werfel
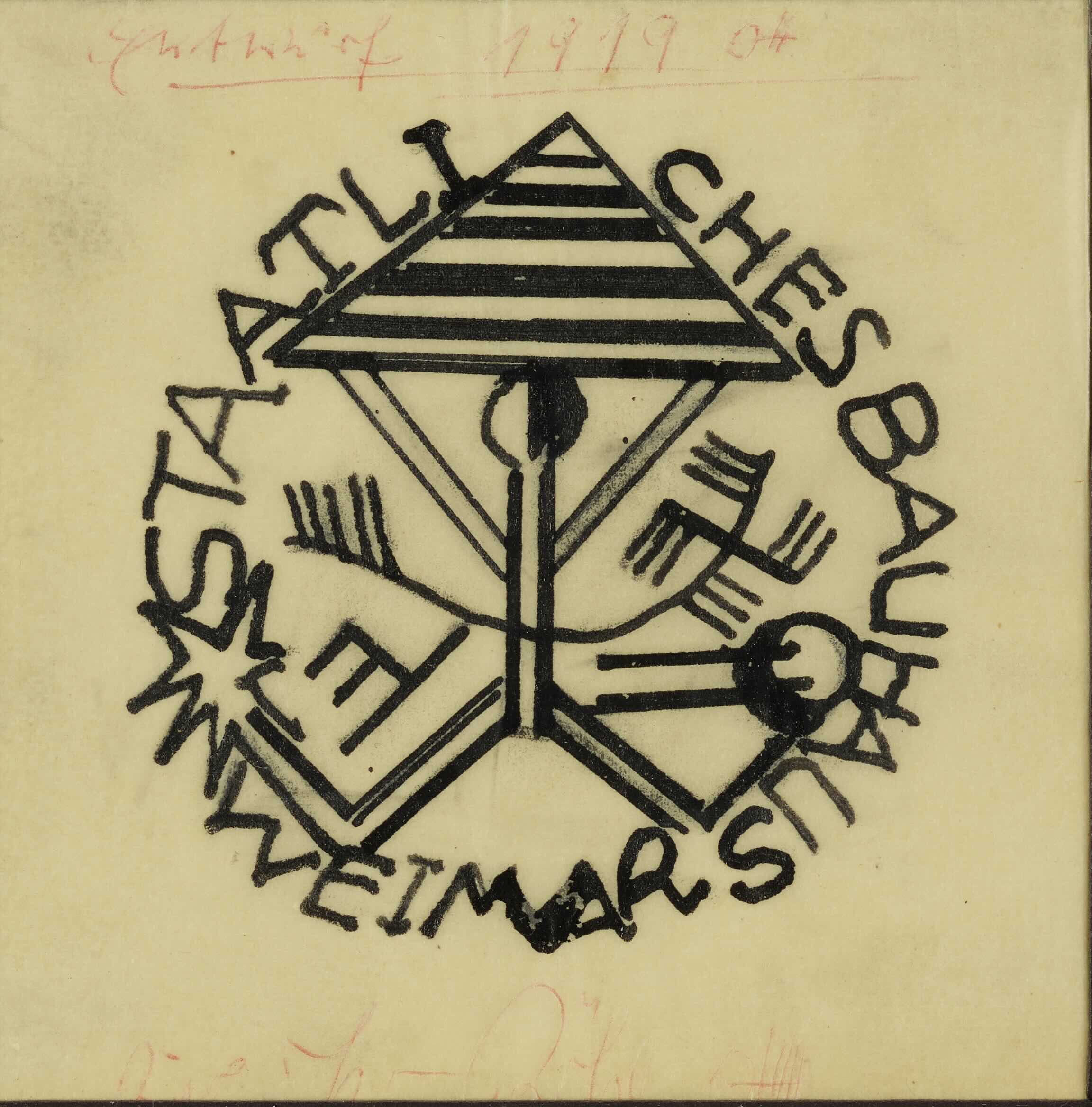
«Endspurt» in Weimar: Urzelle des Bauhauses
nur noch bis 23. Februar 2026
‹Urzelle› des Bauhauses – Karl Peter Röhl und sein Freundeskreis
Bauhaus-Museum Weimar, Stéphane-Hessel-Platz 1, 99423 Weimar
Aus Anlass des 50. Todestages des Bauhäuslers Karl Peter Röhl widmet sich die Klassik Stiftung Weimar in einer Sonderausstellung im Bauhaus-Museum der Bedeutung des Künstlers und seines Freundeskreises für das frühe Weimarer Bauhaus.
Gefördert durch die Karl Peter Röhl Stiftung macht die Ausstellung die Künstler:innen, ihre Netzwerke, die künstlerischen und sozialutopischen Potenziale sowie die produktiven Missverständnisse und Enttäuschungen zum Thema.
Begleitend erscheint ein Katalog (96 Seiten, 72 Abbildungen, 15 €, ISBN 978-3-7443-0806-9).
Bild: Karl Peter Röhl, Sternenmännchen. Entwurf für den Bauhaus-Stempel, 1919, Slg. Freese
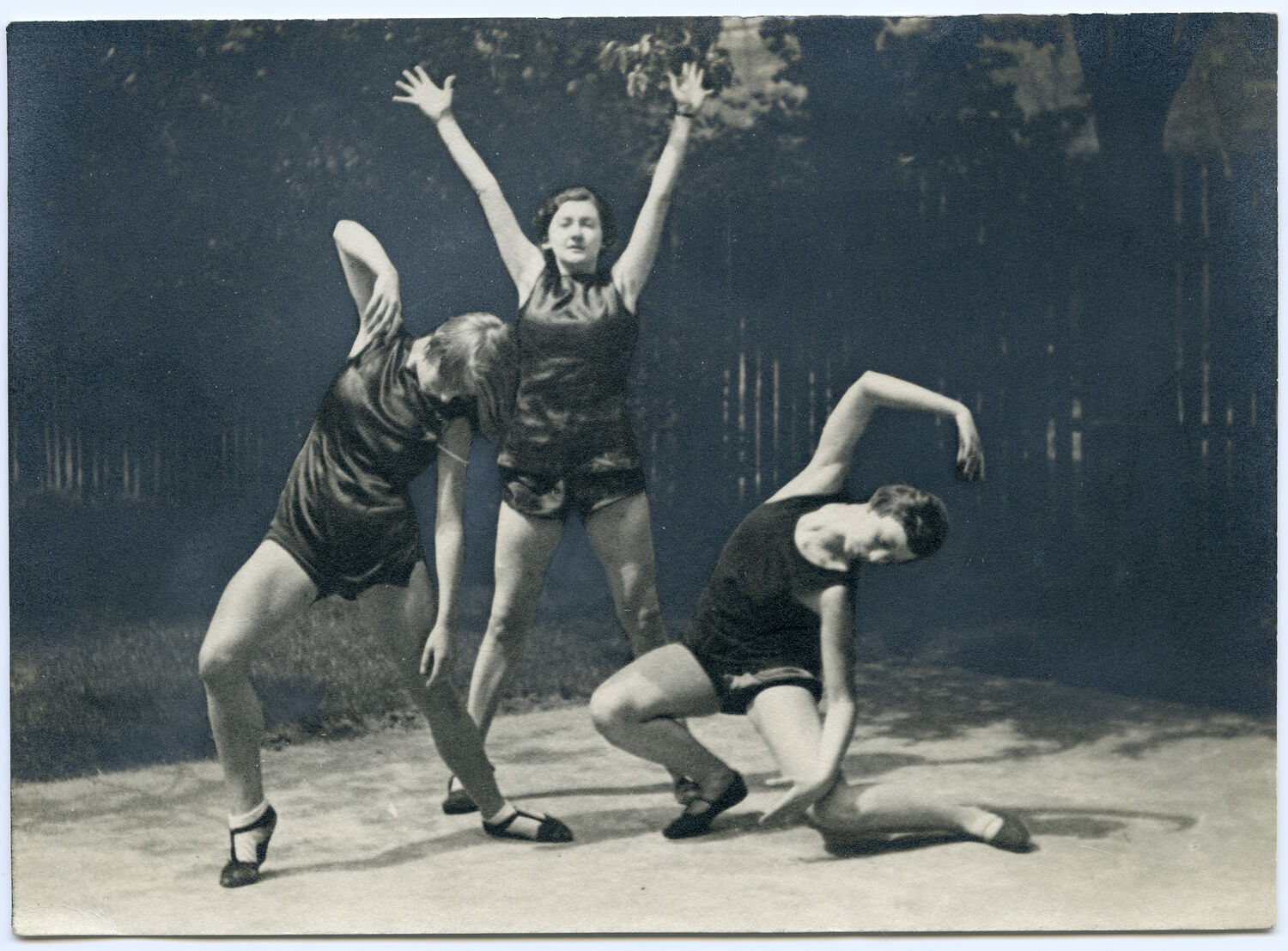
Museum Wiesbaden: KörperGeometrie
nur noch bis 8. Februar 2026
Kabinettausstellung:
KörperGeometrie. Ilse Leda und Friedrich Vordem-Gildewart
Hessisches Landesmuseum für Kunst und Natur
Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden
Die jüdische Tänzerin und Choreografin Ilse Leda (1906—1981) und der konstruktiv arbeitende Künstler Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899—1962) lernten sich um 1925 im dadaistisch geprägten Hannover im Umfeld von Joachim Ringelnatz und Kurt Schwitters kennen. Während ihre Karriere aufgrund des Nationalsozialismus 1937 abriss, konnte Vordemberge-Gildewart verborgen im niederländischen Exil weiterarbeiten. Dass Ledas Einfluss auf seine Werke ab diesem tragischen Punkt ihrer Beziehung größer war, als bisher angenommen, ist Thema der Kabinettausstellung, die die Geschichte einer großen Liebe zweier künstlerisch eng verbundener Menschen erzählt.
Zur Ausstellung ist beim Deutschen Kunstverlag der gleichnamige Katalog erschienen, herausgegeben von Arta Valstar-Verhoff und Roman Zieglgänsberger, 224 Seiten, 30 € an der Museumskasse, ISBN 978-3-422-80283-4.
Bild: «Ausdrucks-Studien» – Schule für Tanz und Gymnastik Ilse Leda – Hannover, fotografiert von Lore Feininger, um 1930.
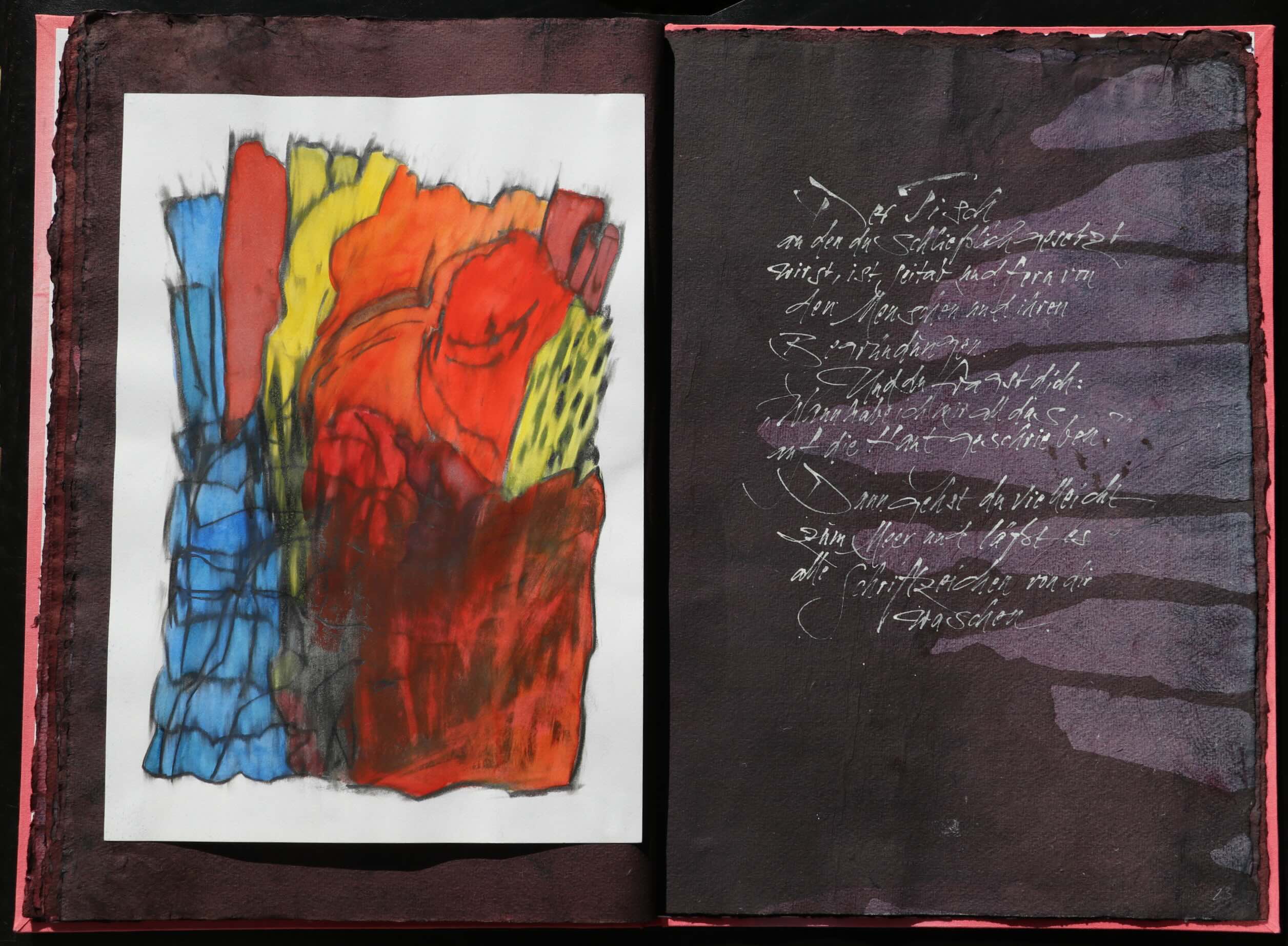
Mainz: Künstlerbücher von Tanja Leonhardt
bis 13. März 2026
Immer wieder zurück zum Buch – Künstlerbücher von Tanja Leonhardt
Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz
Rheinallee 3 B, 55118 Mainz
Mo + Mi 10 bis 18 Uhr, Di 10 bis 17 Uhr, Do + Fr 10 bis 13 Uhr
Eintritt frei
Tanja Leonhardt, 1966 geboren, studierte in Mainz Germanistik und Freie Bildende Kunst und schloss als Meisterschülerin in der Schriftklasse von Prof. Alban Grimm und Pamela Stokes mit dem Schwerpunkt Schriftkunst ab. Danach gründete sie im Rhein-Main-Gebiet ihr Atelier Leonhardt, heute wohnt sie im Vogelsberg/Hessen. Neben Auftragsarbeiten und Lehrtätigkeiten (u.a. am Mainzer Institut für Buchwissenschaft) entsteht seit dem Studium auch ein umfangreiches freies Werk, in dem Sprache und ihre Erscheinungsformen eine Rolle spielen.
Immer schon begleitet das Künstlerbuch die unterschiedlichen Schaffensphasen. Die Ausstellung gibt einen Einblick in das Werk der vielseitigen Künstlerin.
Künstlerinnengespräch am 25. Februar 2026, 16.30 bis 17.30 Uhr: Beim gemeinsamen Gang durch die Ausstellung erläutert Tanja Leonhardt ihre Werke, den Entstehungs- und Schaffensprozess. Anmeldung erbeten, siehe Terminkalender.
Bild: Dialog zweier Künstlerpersönlichkeiten – Doppelseite aus dem Buch vom Rot, Aquarell von Martin Dürk. © Tanja Leonhardt
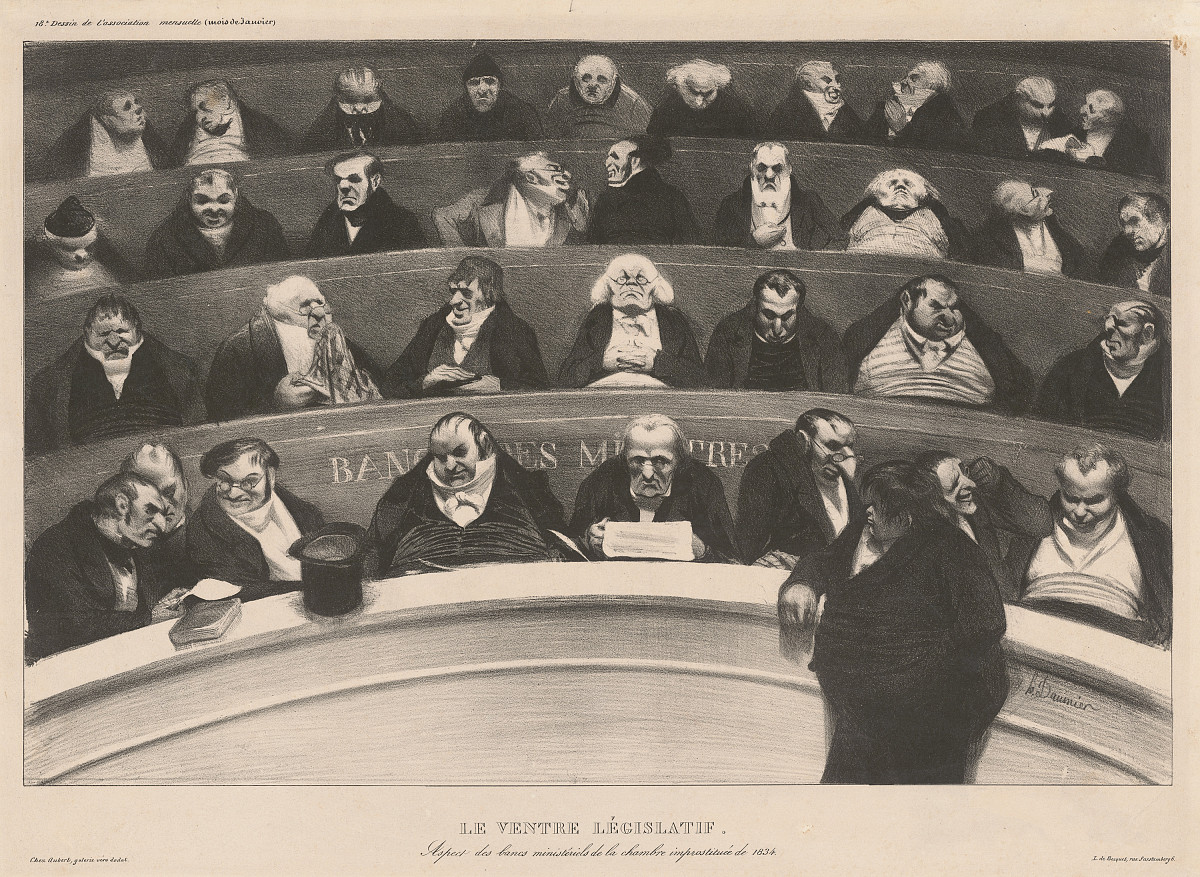
Honoré Daumier in der Albertina Wien
6. Februar bis 25. Mai 2026
Honoré Daumier. Spiegel der Gesellschaft
Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien
Die politische Lage ist instabil, eine ruchlose Clique missbraucht ihre Macht, die Wirtschaft kriselt und die gesellschaftliche Situation wird immer komplexer und unüberschaubarer. Die Schilderung der Verhältnisse im nachrevolutionären Frankreich des 19. Jahrhunderts scheint merkwürdig gegenwärtig und so ist es auch mit der zeitlos aktuellen Kunst des großen Honoré Daumier.
Die ALBERTINA präsentierte die erste große Daumier-Schau 1936 im Angesicht des aufkommenden faschistischen Regimes, kuratiert durch den später in die Emigration getriebenen Ernst Kris. 90 Jahre später zeigt sie unterstützt durch Leihgaben des Städelschen Museumsvereins den französischen Künstler in neuem Licht. Neben zahlreichen Lithographien und Zeichnungen sind auch einige seiner berühmten Gemälde und Skulpturen ausgestellt – sowie ein filmischer Zusammenschnitt der Werke Daumiers, der von Paul und Linda Mcartney mit Musik versehen wurde.
In Kooperation mit dem Städel Museum, Frankfurt am Main.
Bild: Honoré Daumier, Le Ventre législatif, 1834, Lithographie, 28×43,1 cm. © ALBERTINA, Wien
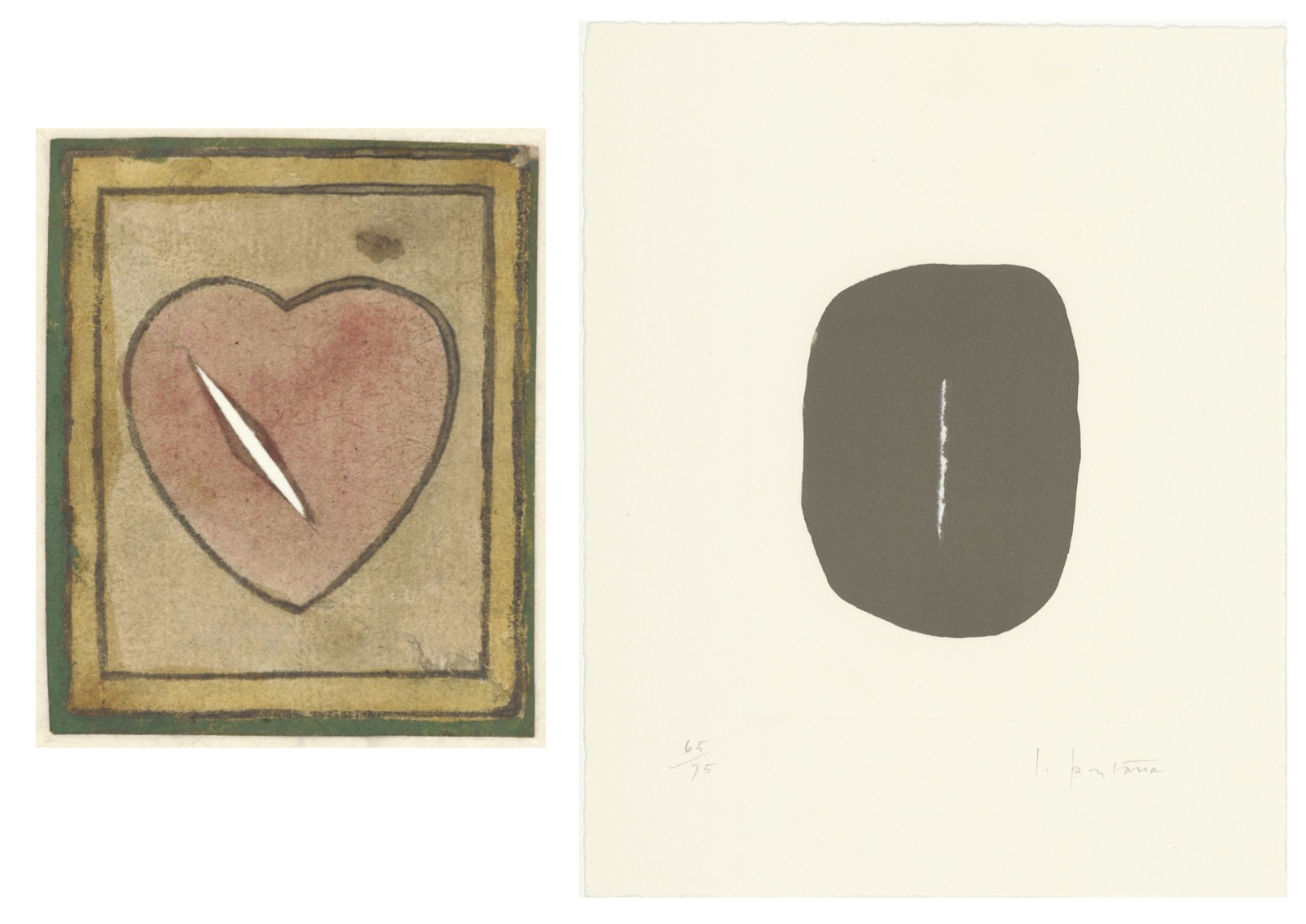
Albertina Wien: «Faszination Papier»
bis 22. März 2026
Faszination Papier. Rembrandt bis Kiefer
Albertina, Basteihalle, Albertinaplatz 1, 1010 Wien
250-Jahr-Jubiläum 2026: Die Ausstellung schöpft ausschließlich aus den reichen Beständen der ALBERTINA, neben Louvre und British Museum eine der größten Sammlungen von Kunst auf Papier weltweit, und zeigt im Jubiläumsjahr in einem epochen- und sammlungsübergreifenden Dialog Papier in seiner Wandelbarkeit, seinen vielfältigen Qualitäten und Dimensionen. Über die Grenzen der Jahrhunderte hinweg begegnen sich historische und zeitgenössische Positionen. Bekannte Meisterwerke treten in Beziehung mit neu entdeckten, selten oder noch nie gezeigten Arbeiten und eröffnen neue Perspektiven auf die Sammlung.
Schnitt, Struktur, Entfaltung, Welt und Kosmos, Wahrnehmung, Identität, Bewegung und manches mehr – in insgesamt zehn technischen und thematischen Kapiteln, die wie ein Parcours angelegt sind, lädt die Ausstellung zum Entdecken dieser faszinierenden Welt aus Papier ein.
Bild: Zwei Mal Schnitt ins Papier – Anonym, Das heilige Herz, vor 1470, Holzschnitt, koloriert, 7,4×6,1 cm, ALBERTINA, Wien und Lucio Fontana, L’epée dans l’eau, 1962, Radierung 14,7×11,2 cm. © Fondation Lucio Fontana, Milano / by SIAE / Bildrecht, Wien 2025

Struwwelpeter Museum: Retrospektive zu Ivan Gantschev
bis 29. März 2026
Ivan Gantschev.
Retrospektive zum 100. Geburtstag des Bilderbuchkünstlers
Struwwelpeter Museum
Hinter dem Lämmchen 2–4, 60311 Frankfurt am Main
Die Ausstellung auf der Galerie präsentiert die magische Bilderwelt von Ivan Gantschev (1925–2014) mit mehr als 70 Originalen, viele davon mit winterlichen Motiven. Der bulgarisch-deutsche Künstler, der über 70 Bilderbücher illustriert hat, lebte seit 1967 in Frankfurt am Main. Die meisten Geschichten zu seinen Büchern hat er selbst geschrieben. Sie handeln immer von Tieren und auch von Menschen, die mit den Tieren zu tun haben. Sie erzählen von Gut und Böse, von der Natur und von Freundschaft.
Eine gemütliche Leseecke bietet Bilderbücher von Ivan Gantschev in verschiedenen Sprachen zum Schmökern an.
Die Ausstellung findet auf der Galerieebene in der dritten Etage des Museums statt und ist leider nicht barrierefrei zugänglich.
Tiere im Schnee © Ivan Gantschev

Mainzer Wissenschaftsstiftung fördert Internationale Gutenberg-Gesellschaft
Die Mainzer Wissenschaftsstiftung unterstützt die Internationale Gutenberg-Gesellschaft in Mainz e.V. mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 100 000 Euro. Die Mittel werden über einen Zeitraum von drei Jahren (2026–2028) bereitgestellt und dienen der nachhaltigen Stärkung der wissenschaftlichen und kulturellen Arbeit der Gesellschaft.
Im Zentrum der Förderung steht der Aufbau einer neuen digitalen Wissenschaftsplattform. Sie soll sowohl die seit über hundert Jahren erschienenen Jahrgänge des Gutenberg-Jahrbuchs digital neu zugänglich machen als auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt die Möglichkeit bieten, neue Forschungsergebnisse aus der Druckforschung und Buchwissenschaft zu publizieren. Ziel ist es, Mainz als internationalen Knotenpunkt der Gutenberg-Forschung weiter zu stärken und neue wissenschaftliche Kooperationen anzustoßen.
«Mit der Plattform öffnen wir das Gutenberg-Jahrbuch konsequent für die internationale Forschung und schaffen zugleich einen neuen Raum für aktuelle wissenschaftliche Debatten. Wir verbinden damit digitale Sichtbarkeit mit persönlichem Austausch – nicht zuletzt im Rahmen unseres Veranstaltungs-programms Gemeinsam für Gutenberg, das wir gemeinsam mit dem Gutenberg-Museum und der Gutenberg Stiftung in Mainz umsetzen», sagt Dr. Carina Weißmann, Geschäftsführerin der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft.
Foto, von links: Gerhard Lauer, Alexander Steinhoff, Werner von Bergen, OB Nino Haase, Carina Weißmann, Ulf Sölter. © Markus Kohz

Klingspor Museum: 70. Internationale Kinderbuchausstellung
bis 15. März 2026
70. Internationale Kinderbuchausstellung
Klingspor Museum, Herrnstraße 80, 63065 Offenbach
Wie in jedem Jahr sind wieder um die 150 Neuerscheinungen aus vielen Ländern ausgewählt, die besonders schön gestaltet oder erzählt sind. Aber auch das Jubiläum wird gebührend gefeiert und bietet Anlass, über Vergangenheit und Zukunft des Bilderbuches nachzudenken.
Präsentiert wird eine Rückschau auf sieben Jahrzehnte Kinderbuch. Die Ausstellung zeigt, wie sich die Themen und die Formensprache im Laufe der Zeit verändert haben. Was ist alles auf dem Kinderbuchmarkt los gewesen, welche Ausgaben sind heute Kult, und was würde heute nicht mehr so im Regal landen? Und was erwartet das Kinderbuch wohl in der Zukunft?
Neben der Rückschau aus den umfangreichen Beständen des Museums werden Originalaquarelle des Künstlers Ivan Gantschev (1925–2014) gezeigt.
Foto © Silvia Werfel

Klingspor Museum: Gespräch zu Ivan Gantschev
30. Januar 2026, 19 Uhr
Jahrzehnte für das Bilderbuch: 100 Jahre Ivan Gantschev
Präsentation und Gespräch
Klingspor Museum, Herrnstraße 80, 63065 Offenbach
Eintritt nach Wahl
Im Rahmen der 70. Internationalen Kinderbuchausstellung im Klingspor Museum richtet sich das Augenmerk nicht nur auf das Ausstellungsjubiläum, sondern auch auf einen besonderen Künstler: auf den Maler und Illustrator Ivan Gantschev (1925–2014). Der aus Bulgarien stammende, seit 1967 in Frankfurt am Main lebende Künstler war eine prägende Gestalt im Bilderbuch der 1970er und 1980er Jahre. Seine ruhigen poetischen Bücher, die oft Motive seiner Heimat zeigten, wurden vielfach ausgezeichnet.
Aus seinen umfangreichen Beständen zeigt das Klingspor Museum neben einigen Bilderbüchern auch Originalaquarelle von Ivan Gantschev. Außerdem gibt es am 30. Januar eine besondere Präsentation und ein Gespräch mit der Tochter Igna Gantschev.
Das Struwwelpeter Museum in der Frankfurter Altstadt widmet Ivan Gantschev eine eigene kleine Ausstellung. Dazu gibt es eine eigene Bibliophile Notiz.
Zwei Aquarelle von Ivan Gantschev, Foto © Simon Malz
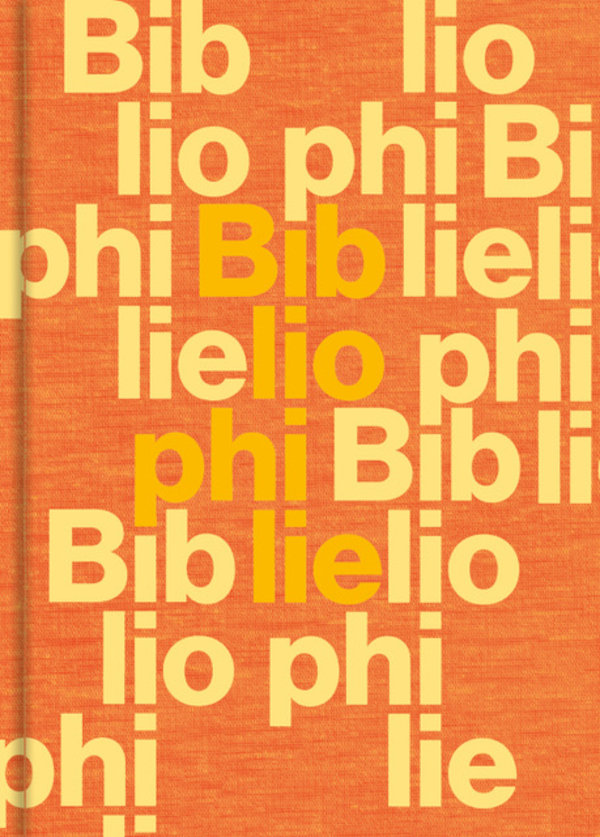
Neues Standardwerk zur Bibliophilie mit Subskriptionsangebot
Frisch erschienen ist bei Hiersemann der über 600 Seiten umfassende Band Bibliophilie von Ernst Fischer.
Entstanden ist das Werk aus der Auseinandersetzung mit G. A. E. Bogengs Einführung in die Bibliophilie (1931). Der Autor nähert sich dem Thema sodann auf vier Ebenen: Er erläutert zentrale Fragen und aktuelle Entwicklungstendenzen, zeichnet Grundlinien der Geschichte des Büchersammelns nach, gibt einen ausführlichen Überblick über die Vielzahl an Sammelgebieten und behandelt jene Gestaltungs- und Materialitätselemente, die das Buch zu einem sinnlich-ästhetischen Gegenstand machen.
Ernst Fischer (geb. 1951 in Wien) war nach der Habilitation in München 1993 bis 2014 als Professor für Buchwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz tätig; nach mehrjähriger Mitarbeit im Vorstand der Maximilian-Gesellschaft ist er seit 2018 Vorsitzender der Wiener Bibliophilen-Gesellschaft.
Subskriptionspreis für Vorbestellungen, gültig bis 31. Januar 2026: 159 €, danach 196 €.
Für Sammler ist der Band auch in zusammengetragenen und noch nicht fadengehefteten Buchblocks ohne Einbanddecke erhältlich. Ladenpreis 96 €. Bestellungen bitte an verlag@hiersemann.de.
Das Buch wird in der Frühjahrsausgabe der Wandelhalle für Bücherfreunde vorgestellt.

UB Basel: 150 Jahre HAG
2 Vitrinenausstellungen:
bis Februar 2026
Universitätsbibliothek Basel
bis 12. April 2026
Historisches Museum Basel
Vor 150 Jahren fusionierten die 1836 begründete Historische Gesellschaft und die 1842 aus ihr abgezweigte Antiquarische Gesellschaft zur Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel: HAG_Basel.
Aus Anlass ihres Jubiläums präsentiert die HAG in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Basel und dem Historischen Museum im Historischen Museum und in der Universitätsbibliothek je eine Vitrinenausstellung. Während in ersterer anhand von ausgewählten Objekten und Dokumenten die Sammel- und Forschertätigkeit der Gesellschaft thematisiert wird, würdigt die Vitrine in der UB die Vortrags- und Publikationstätigkeit der HAG.
Foto: © Universitätsbibliothek Basel
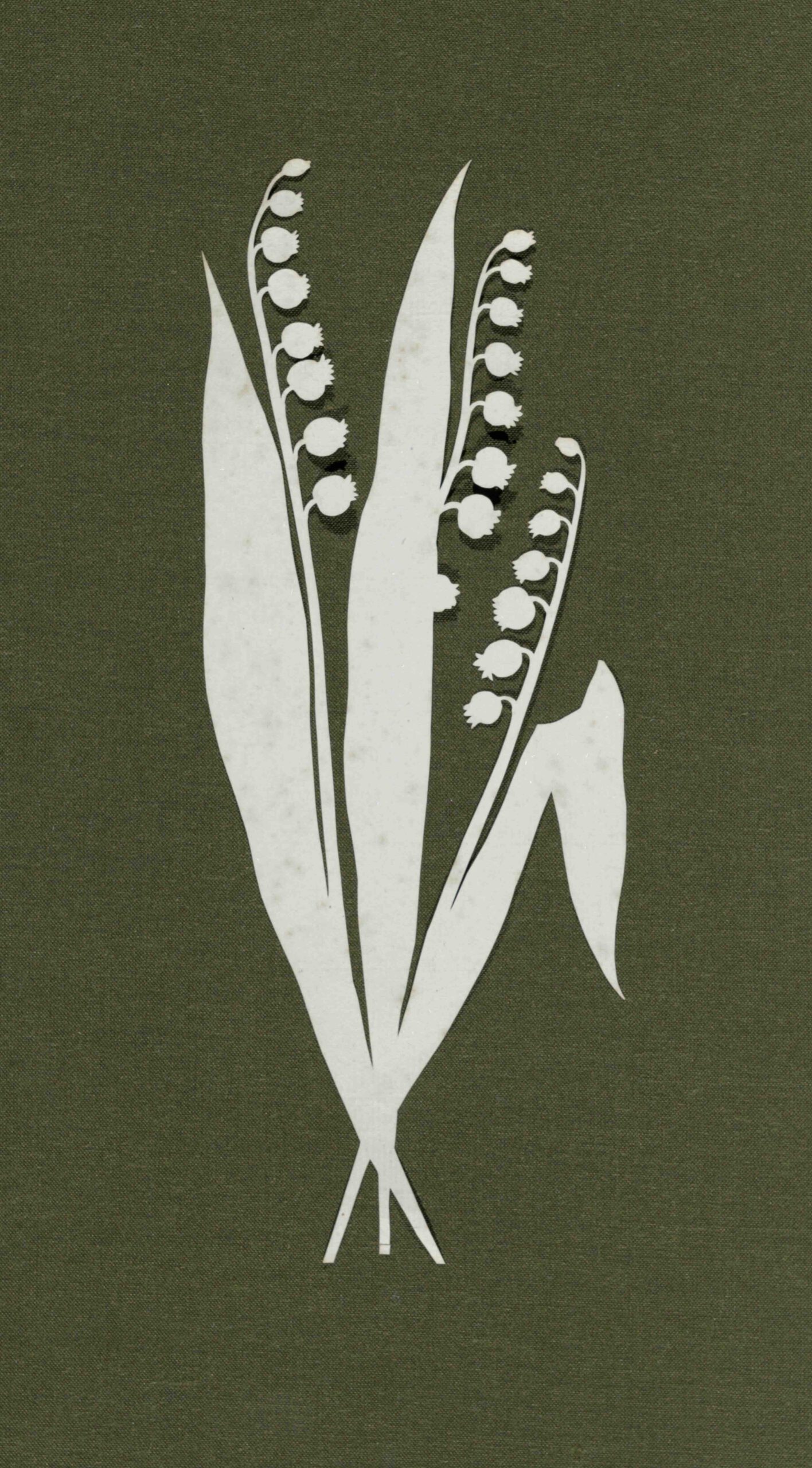
KSW hat bislang unbekannte Scherenschnitte von Philipp Otto Runge erworben
Blumen für Weimar – Die Museen der Klassik Stiftung Weimar haben gemeinsam mit der Ernst von Siemens Kunststiftung fünf Scherenschnitte von Philipp Otto Runge für ihre bedeutenden Graphischen Sammlungen erworben. Sie stammen aus dem Nachlass der mit dem Romantiker befreundeten Hamburger Künstlerfamilie Speckter und blieben bis heute im Besitz von Nachfahren. Das Konvolut aus Flieder, Maiglöckchen, Margerite, Narzisse und Nelke war bisher unbekannt.
Für Weimar haben Runges Scherenschnitte eine singuläre Bedeutung, die von seinem Verhältnis zu Johann Wolfgang von Goethe herrührt. Bereits seit der Jahrhundertwende standen Runge und Goethe in Kontakt. 1806 sandte Runge eine größere Anzahl von Blumenschnitten als Geschenk an den Dichter, der mit ihnen das Musikzimmer (das heutige Junozimmer) in seinem Wohnhaus am Frauenplan auszustatten gedachte. Keines dieser Werke hat sich in Goethes Sammlung erhalten.
Die Direktorin der Museen, Dr. Annette Ludwig, unterstreicht: «Mit dieser wichtigen Neuerwerbung bringen wir Runge nach mehr als zweihundert Jahren wieder ins Goethehaus zurück, wofür unser herzlichster Dank der Ernst von Siemens Kunststiftung für die großzügige Förderung gebührt. Mit den raren Blättern des jung verstorbenen Künstlers schließen wir eine empfindliche Lücke in unserer Sammlung und können veranschaulichen, wie wichtig sie Goethe gerade auch in Krisenzeiten waren. Noch vor der sanierungsbedingten Schließung werden wir sie für unsere Gäste direkt im Wohnhaus präsentieren.»
Abbildung: Philipp Otto Runge, Maiglöckchen, um 1805, Klassik Stiftung Weimar, Museen

CMF: Das kann nur Perscheid
bis 7. Juni 2026
Das kann nur Perscheid. Das Beste aus Perscheids Abgründen
Caricatura Museum für Komische Kunst Frankfurt
Weckmarkt 17, 60311 Frankfurt am Main
Mit dieser Ausstellung ehrt das Caricatura Museum Frankfurt den legendären Cartoonisten Martin Perscheid anlässlich seines 60. Geburtstags am 16. Februar 2026. Der 2021 an den Folgen einer Krebserkrankung viel zu früh verstorbene Zeichner gilt als einer der prägenden Vorbilder und Wegbereiter der Komischen Kunst.
Mit Perscheids Cartoons schaut man lachend in unermessliche und gefährliche Tiefen, bevor man merkt, worüber man da eigentlich lacht. Denn ganz weit unten lauert das Unfassbare, das scheinbar Unsag- und Undenkbare. Und doch: Bei aller Boshaftigkeit und allem Zynismus halten seine Cartoons das nötige Gleichgewicht zwischen Tabu und Witz, Spott und Leichtigkeit. Dieser akrobatische Balanceakt ist die große Kunst des schwarzen Humors, die Perscheid meisterhaft beherrschte. Dabei verschonte er nichts und niemanden: Tiere, Eltern, Autofahrer und -fahrerinnen, Beziehungen, Frauen und auch Perscheids eigenes Alter Ego bewegen sich gefährlich nah am Rand des Abgrunds.
Geboren in Wesseling bei Köln, äußerte er bereits als Fünfjähriger den Wunsch, mit eigenen Bildern Geld zu verdienen. Er absolvierte schließlich das Fachabitur und anschließend eine Lehre als Druckvorlagenhersteller. Nachdem er zunächst als Werbegrafiker für Mode in Düsseldorf gearbeitet und sein erstes Cartoon Trendman veröffentlicht hatte, entschied er sich 1993 für die Laufbahn des freischaffenden Cartoonisten. Allein unter seiner populären Reihe Perscheids Abgründe erschienen mehr als 4300 Cartoons, gezeichnet in zweiwöchentlichen Zyklen.
Schon früh entschied sich Martin Perscheid für die Veröffentlichung seiner Werke auf einer eigens eingerichteten Facebook-Seite. Auch auf seiner nach wie vor existierenden Website martin-perscheid.de sind seine Cartoons bis zur Nummer A 4252 in einer eigenen Systematik sortiert. Heute sind über 242 000 Personen Mitglied in der Facebook-Gruppe Perscheid Cartoons 3.0, die sich auch für die Fortführung der Datenbank (idioten-die-im-wege-stehen.de) mit textbasierter Suche verantwortlich zeigen.
Der zur Ausstellung bei Lappan neu erschienene opulente Cartoonband präsentiert auf 240 Seiten neben Perscheids besten Werken auch seine Installationskunst, die er gemeinsam mit seinem Freund und Künstler-Kollegen Dirk Schmitt geschaffen hat. Er kostet 22 €.
Bild: Fischstäbchen braten © Martin Perscheid
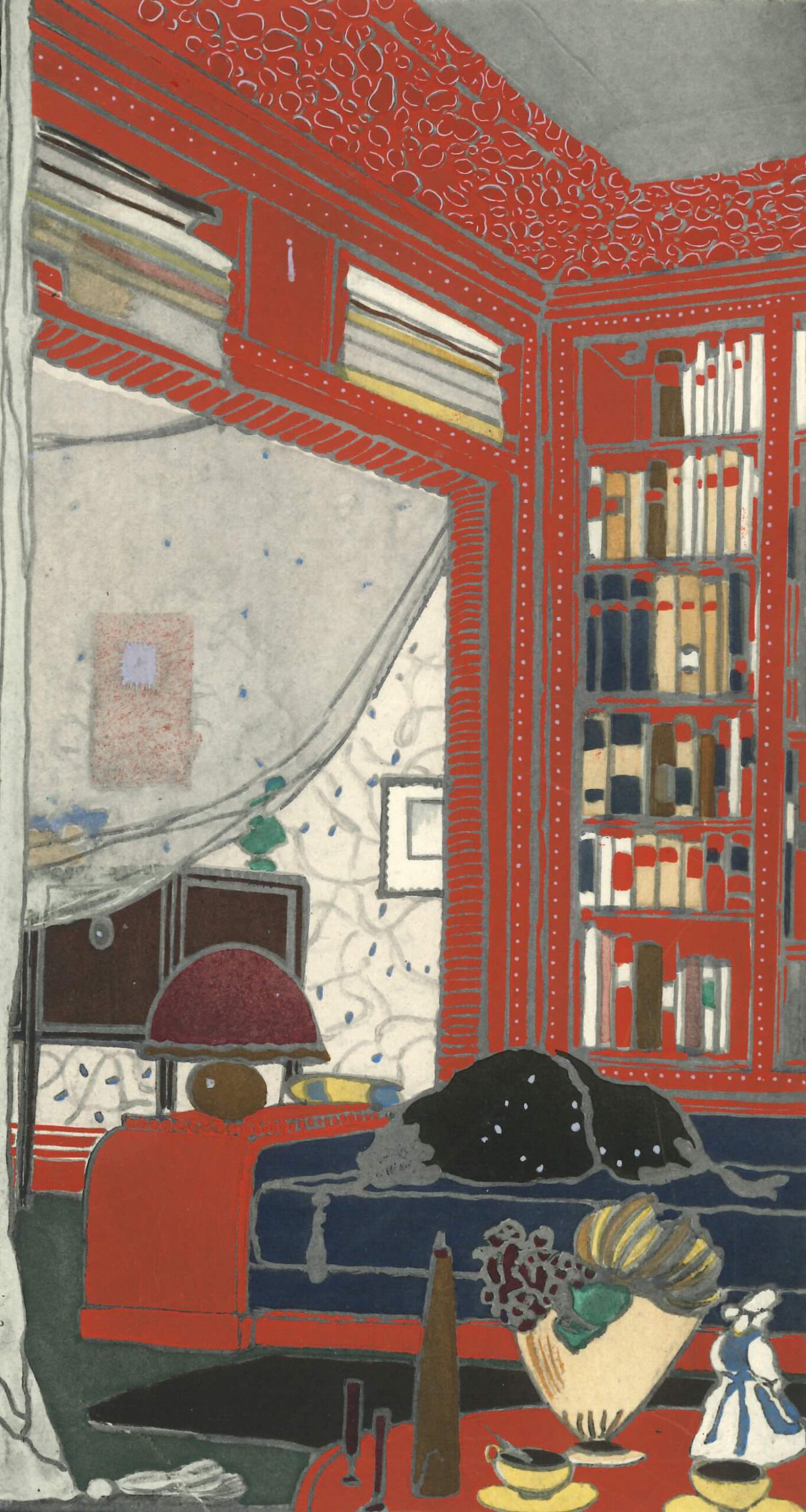
Bröhan: Glamour und Geometrie. Art Déco in der Illustration
bis 26. April 2026
Glamour und Geometrie. Art Déco in der Illustration. Blackbox #17
Bröhan-Museum, Schloßstraße 1a, 14059 Berlin (Charlottenburg)
Der Glanz des Art Déco entfaltete sich nicht nur in Möbeln, Glas und Metall, sondern ebenso auf Papier: In Illustrationen für Zeitschriften und Werbung fand der Stil eine besonders schillernde Bühne. Diese grafischen Zeugnisse prägten das Bild der Moderne entscheidend – sie machten den Luxus der neuen Zeit sichtbar, multiplizierbar und massenwirksam. Dabei waren sie alles andere als trivial: Modezeitschriften jener Zeit waren kleine Kunstwerke, gedruckt auf edlem Papier und gefertigt im aufwendigen Au-Pochoir-Verfahren. Dieses Verfahren war perfekt geeignet, um die Entwürfe der großen Couturiers und Couturières wie Paul Poiret, Jeanne Lanvin oder Madeleine Vionnet zu vervielfältigen, ohne ihnen etwas von ihrer Strahlkraft zu nehmen.
Neben der Mode wurde die Raumgestaltung zum bevorzugten Ausdrucksfeld von Stil und Individualität. Die kostbare Ausstattung der eigenen vier Wände bot Gelegenheit, Wohlstand und verfeinerten Geschmack zur Schau zu stellen.
Die Ausstellung widmet sich diesen außergewöhnlichen Druckerzeugnissen und eröffnet einen faszinierenden Blick auf die herausragende Illustrationskunst der Art-Déco-Zeit. Alle gezeigten Werke entstammen der einzigartigen Kollektion des Stuttgarter Sammlerehepaars Akka und Wulf D. von Lucius, die mit dieser Präsentation erstmals in Berlin zu sehen ist.
Bild: Boudoir-Bibliothèque, 1918, Entwurf Jacques-Emile Ruhlmann in: Harmonies. Intérieurs de Ruhlmann, Paris 1924, Hg. Jean Badovici / Éditions Albert Morancé. Sammlung Lucius

Wechsel im Vorstand des Leipziger Bibliophilen-Abends e.V.
Der Leipziger Bibliophilen-Abend e.V. (LBA) hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden:
Nach 12 Jahren als Vorsitzender hat Dr. Thomas Glöß das Ehrenamt abgegeben. Mit 148 Veranstaltungen, 9 Messebeteiligungen, 25 Publikationen und einer Vereinsmitgliederzahl von über 200 konnte auf der Wahlveranstaltung eine sehr positive Bilanz gezogen werden. Neuer Vorsitzender des Vereins ist der Leipziger Architekt Gregor Fuchshuber.
Fotos:
Thomas Glöß (links) © Christiane Gundlach; Gregor Fuchshuber © Uwe Frauendorf

Antiquaria-Preis 2026 für Rotraut Susanne Berner
Der mit 10 000 € dotierte, vom Verein Buchkultur e.V., der Stadt Ludwigsburg und der Wiedeking Stiftung Stuttgart gestiftete 31. Antiquaria-Preis für Buchkultur wird der Illustratorin und Buchgestalterin Rotraut Susanne Berner zuerkannt.
«Die 1948 in Stuttgart geborene Illustratorin, Buchgestalterin und Autorin hat mit unverwechselbarem zeichnerischem Duktus ein umfangreiches Kinderbuch-Œuvre geschaffen, darunter Bestseller wie die Wimmelbücher und die Karlchen-Geschichten. Daneben entstanden zahlreiche Bilder und Umschläge für Titel von Sylvia Plath und Luigi Malerba, Julien Green und Charles Bukowski, Helmut Eisendle und H. M. Enzensberger – ein Kontinuum der Fülle origineller Illustrationskunst.» (aus der Jurybegründung)
Manches hat sie zu der Reihe Die tollen Hefte (erst im MaroVerlag, dann in der Büchergilde Gutenberg) beigetragen, deren Herausgeberschaft sie nach dem Tod ihres Mannes Armin Abmeier 2012 übernahm (bis 2019). Seine Tolle Galerie für Illustration und Comic-Art führte sie bis 2014 weiter. Sie lebt und arbeitet in München.
Die feierliche Preisverleihung findet am 22. Januar 2026 im «Podium» der Musikhalle Ludwigsburg statt (Beginn 20:15 Uhr). Die Laudatio wird Martin Bauer, Kollegforschungsgruppe «Applied Humanities: Genealogy and Politics», Humboldt-Universität zu Berlin, halten.
Foto © Manu Theobald
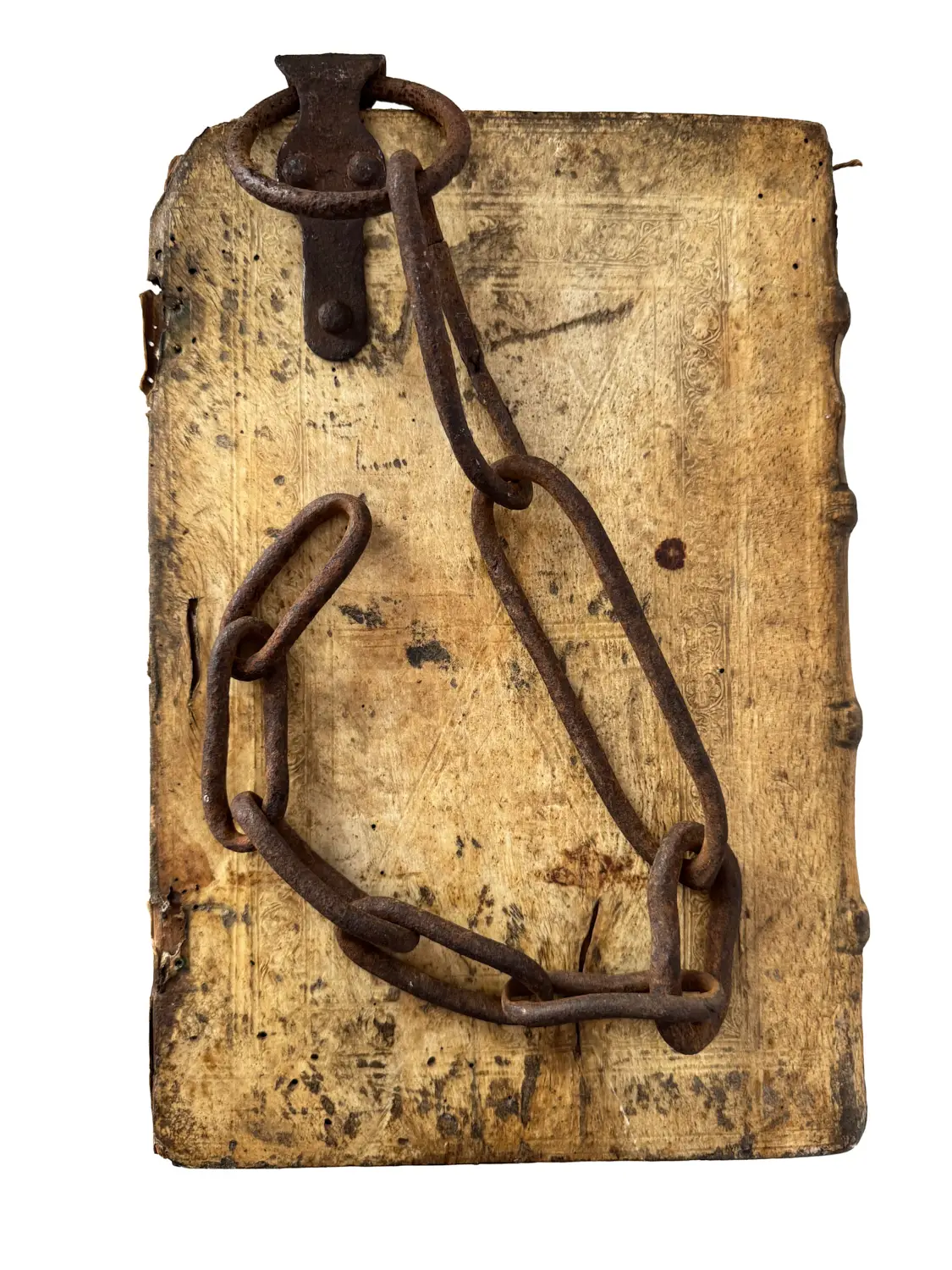
40. Antiquaria Ludwigsburg
40. Antiquaria – Antiquariatsmesse Ludwigsburg
22. Januar 2026: 15 bis 20 Uhr
23. Januar 2026: 11 bis 19 Uhr
24. Januar 2026: 11 bis 17 Uhr
Ort: Musikhalle Ludwigsburg, Bahnhofstraße 19, 71638 Ludwigsburg (gegenüber dem Bahnhof)
Eintrittskarte für alle drei Tage: 5 €
freier Eintritt für alle unter 40 Jahren
Vierzig Jahre Vielfalt könnte das Motto dieser Antiquaria lauten, die 2026 kein offizielles Rahmenthema hat. Ein spannendes Angebot von seltenen, kuriosen und einzigartigen antiquarischen Büchern, Autographen und Graphiken vom 15. bis 20. Jahrhundert aus allen Sammelbereichen erwartet die Besucher:innen. Der Messekatalog steht hier zum Download bereit:
antiquaria_2026
Der 31. Antiquaria-Preis zur Förderung der Buchkultur wird am Abend des Eröffnungstages im «Podium», Musikhalle Ludwigsburg verliehen (Beginn 20:15 Uhr). Dazu gibt es eine eigene Notiz.
Abbildung:
«Kettenbücher», schreibt der Antiquar Michael Solder aus Münster in seinem Katalogbeitrag, «sind von größter Seltenheit, besonders wenn, wie hier, die originale handgeschmiedete Kette mit Befestigung und 8 Gliedern vermutlich vollständig erhalten sind.» Dieses Repertorium wurde 1511 in Basel gedruckt, 13 850 Euro soll der zeitgenössische Schweinslederband einspielen.
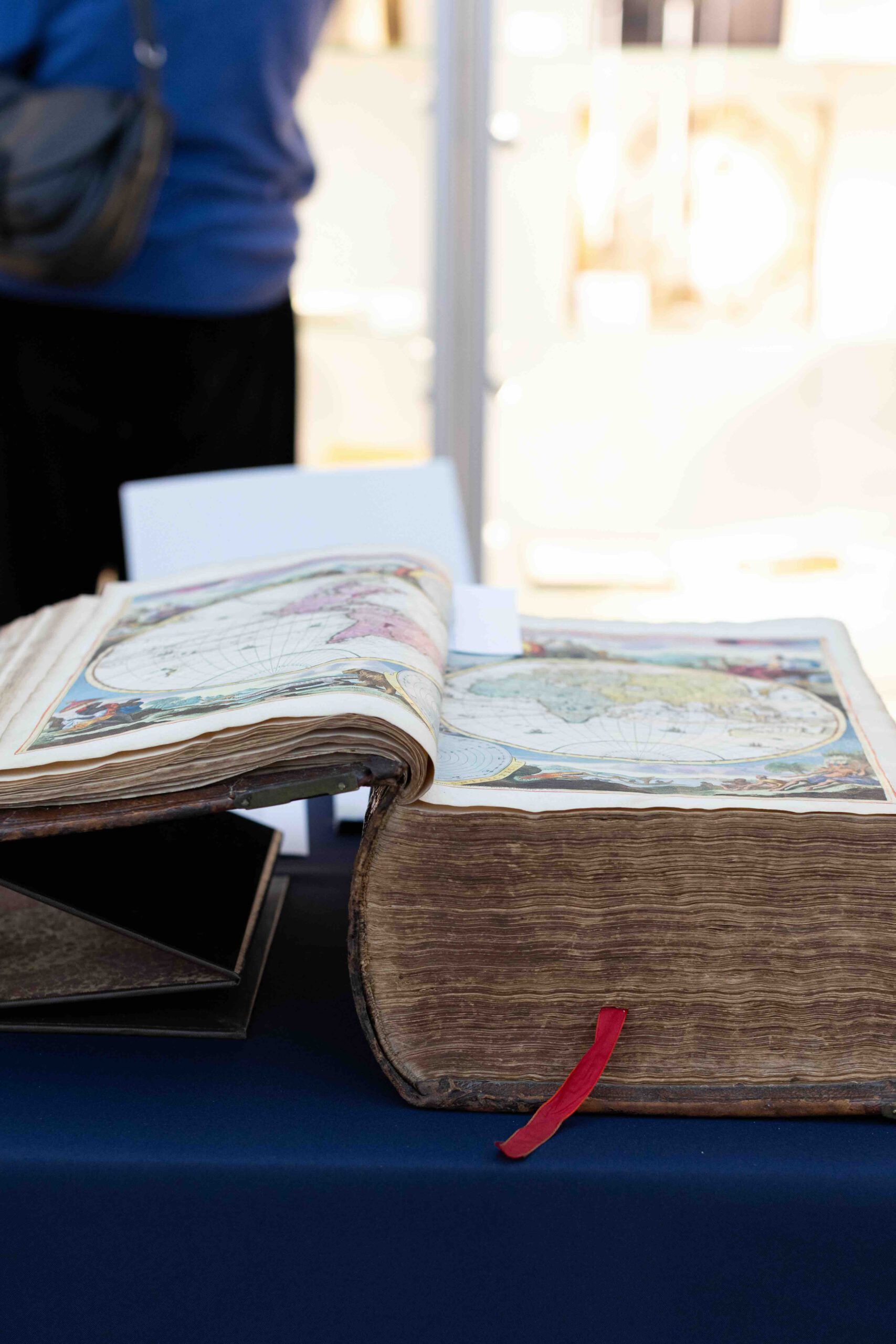
62. Antiquariatsmesse Stuttgart an neuem Ort
62. Antiquariatsmesse Stuttgart
23. Januar 2024 – 11 Uhr bis 19:30 Uhr
24. Januar 2024 – 11 Uhr bis 18 Uhr
25. Januar 2024 – 11 Uhr bis 17 Uhr
neuer Ort: Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, Schiller-Saal
Berliner Platz 1–3, 70174 Stuttgart
Neustart: Ein frisch formiertes Team des Verbandes Deutscher Antiquare e. V. hat einen Neustart gewagt. Unter der Leitung des Messeausschusses – bestehend aus Bálazs Jádi, Dr. Karl Klittich, Roger Sonnewald, Hans Lindner, Norbert Knöll und Thomas Haufe – wurde die Antiquariatsmesse neu gedacht und verbindet jetzt stärker Altes mit Modernem und Zeitgenössischen.
Mit mehr als 70 Antiquariaten aus 11 Ländern (u.a. USA, UK, FR, I, A, CH), darunter zahlreiche internationale Experten, verspricht die Messe ein breiteres und hochkarätigeres Spektrum an Raritäten als je zuvor.
Die Messe bietet ein vielfältiges Rahmenprogramm, außerdem lädt der neue Bereich Young Collectors Zone & Design & Buchästhetik Sammler:innen der jüngeren Generation ein, sich auszutauschen, zu lernen und die bibliophile Leidenschaft mit anderen zu teilen. Unter dem Motto Women & Bookcraft sind erstmals auch Themen wie Buchgestaltung, Illustration und die Rolle von Frauen in der Buchkultur stärker präsent.
Angeboten werden zudem Führungen durch die Antiquariatsmesse (Dauer: ca. 15 bis 30 Min., max. 15 Personen). Treffpunkt: die Cafeteria im Schiller-Foyer.
Mehr Informationen:
Stuttgarter_Antiquariatsmesse_2026
Abbildung:
Messeimpression. Foto: Stuttgarter Antiquariatsmesse 2025
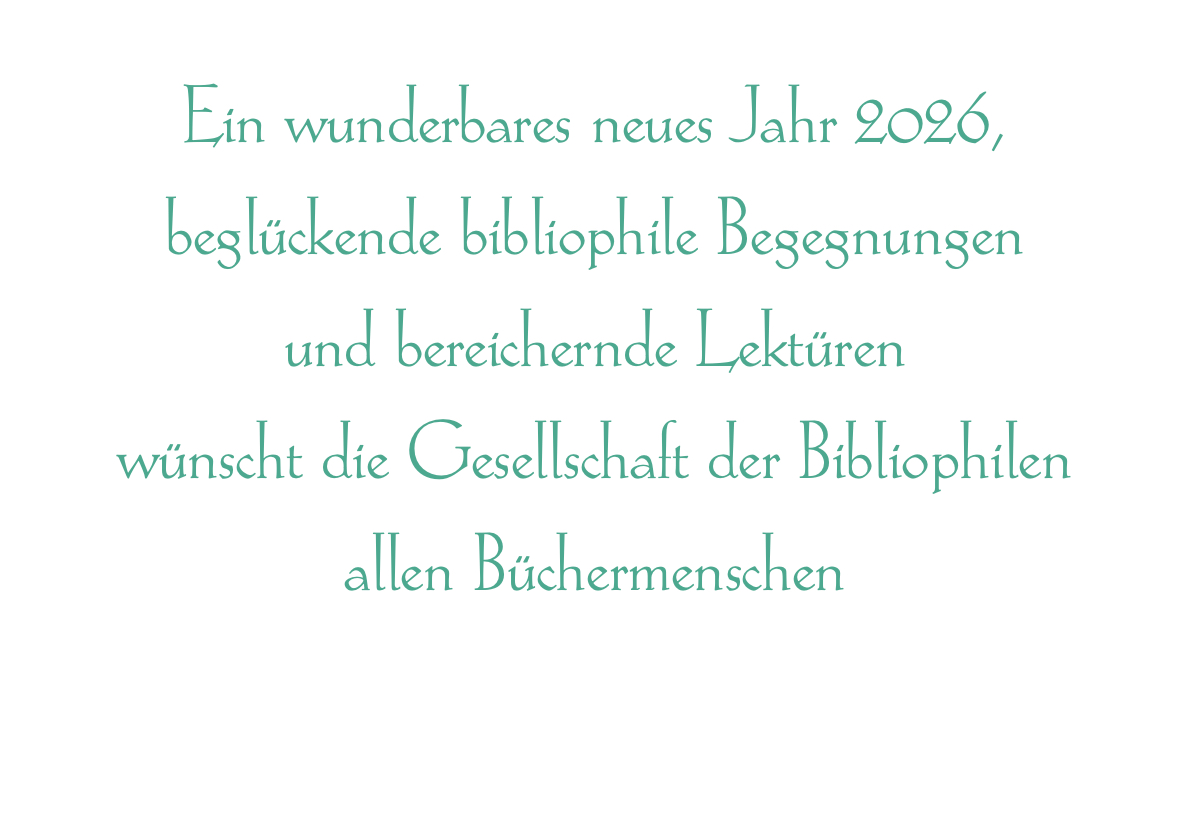
Bibliophile Neujahrsgrüße 2026
[ … gesetzt aus der Koch-Antiqua von Rudolf Koch (1876–1934), als Bleisatzschrift mit geradestehenden und kursiven Schnitten 1922 bei Gebr. Klingspor in Offenbach am Main erschienen ]

In eigener Sache: die GdB auf Instagram
Einladung zu einer Entdeckungsreise!
Seit dem 1. November ist die Gesellschaft der Bibliophilen auf Instagram aktiv, künftig an allen 365 Tagen des Jahres. Die Beiträge folgen dabei dem Muster eines Abreißkalenders rund um das Thema Buch. Jedem Wochentag ist eine Kategorie zugeordnet. Wissenswertes und auch Überraschendes finden sich zu den Stichwörtern Buchzitat, Buchevent, Buchpersönlichkeit, Buchrekord, WörterBuch, Imprimatur und Überallbuch, und zwar hier:
GdB_Instagram
Größter Dank geht an Herrn Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik, Schriftführer im Vorstand der GdB, und seine Studentinnen an der Hochschule RheinMain Wiesbaden für die Initiative und die Konzeption des Social-Media-Auftritts. Die Umsetzung übernahm die Agentur Mediengewerk aus Wiesbaden (mediengewerk).
Viel Freude beim Lesen und Entdecken! Und: weitersagen …
(siw)

Staatsbibliothek zu Berlin: Jüdische Buchkunst im rituellen Kontext
bis 25. Januar 2026
Materialisierte Heiligkeit
Jüdische Buchkunst im rituellen Kontext
Stabi Kulturwerk, Staatsbibliothek zu Berlin
Unter den Linden 8, 10117 Berlin
Heilige Bücher sind das Herzstück der jüdischen Schriftkultur, die sich seit ihren Anfängen im antiken Israel bis in die Gegenwart in beeindruckender Vielfalt und ästhetischer Ausdruckskraft entfaltet hat. Abschriften der Hebräischen Bibel, liturgische Schriftrollen und Gebetsbücher für die Feiertage strukturieren den Rhythmus von Lehre, Gebet und religiösem Ritus in der Synagoge – und schaffen so einen Raum kultureller Identität jenseits des Alltäglichen.
Die Ausstellung präsentiert ausgewählte hebräische Handschriften aus der bedeutenden Hebraica-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin und eröffnet faszinierende Einblicke in die jüdische Buchkunst und ihren kulturellen Kontext. An herausragenden Stücken der berühmten Erfurter Sammlung lassen sich etwa die kunstvolle hebräische Mikrographie, Spuren christlicher Hebraistik sowie die rituelle Herstellung von Torarollen studieren – darunter die größte hebräische Bibel des Mittelalters, zwei außergewöhnlich gut erhaltene aschkenasische Torarollen und ein großformatiges Gebetsbuch aus dem 14. Jahrhundert.
Veranstaltungen:
Di, 25. November 2025, 19 Uhr
Die Coplas Sefardies von Alberto Hemsi
Moderiertes Konzert mit Assaf Levitin (Gesang) und Na’aman Wagner (Klavier)
Weitere Infos und Anmeldung hier.
Di, 13. Januar 2026, 18 Uhr
Die Restaurierung der Erfurter Bibel
Vortrag von Restauratorinnen Ira Glasa und Christine Theuerkauf-Rietz
Weitere Infos und Anmeldung hier.
Bild: Detail aus einem mittelalterlichen jüdischen Gebetbuch (Staatsbibliothek zu Berlin, Orientabteilung, Ms. or. fol. 388, f. 148r), © Stabi Berlin

JMB: Widerstände. Jüdische Designerinnen der Moderne
bis 23. November 2025
Widerstände. Jüdische Designerinnen der Moderne
Jüdisches Museum Berlin
Libeskind-Bau 1. OG, Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin
Erstmals präsentiert eine Ausstellung Biografien und Werke heute vergessener jüdischer Designerinnen. Das JMB hebt ihre künstlerischen und unternehmerischen Leistungen sowie ihre Positionen innerhalb der Emanzipations- und Modernisierungsprozesse der deutschen Gesellschaft im frühen 20. Jahrhundert vor – als Frauen, Jüdinnen und Künstlerinnen.
Mit rund 400 Exponaten von mehr als 60 Gestalterinnen vereint die Präsentation Pionierinnen, die sich trotz gesellschaftlicher Marginalisierung herausragende Positionen erkämpften, bis das nationalsozialistische Regime ihre Karrieren und Leben zerstörte. Einigen gelang die Flucht und ein Neubeginn im Ausland.
Zu den künstlerischen Disziplinen gehören neben Keramik, Modedesign, Goldschmiede- und Textilkunst auch Gebrauchsgrafik (Reklame, Exlibris), Buchgestaltung und Illustration; genannt seien hier nur Elisabeth Friedländer, Elli Hirsch, Franziska Schlopsnies, Käte Wolff und Tom Seidmann-Freud.
Ein Ateliergespräch am Mittwoch, den 5. November 2025, 18.30 Uhr, stellt das Leben und Schaffen der Grafikerin Franziska Baruch, der Weberin Trude Guermonprez und der Keramikerin Marguerite Friedlaender-Wildenhain in den Mittelpunkt. Veranstaltungsort:
W. M. Blumenthal Akademie, Klaus Mangold Auditorium
Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz 1, 10969 Berlin (gegenüber dem Museum)
Katalog zur Ausstellung: Widerstände. Jüdische Designerinnen der Moderne. Hrsg. v. Michal S. Friedlander, Stiftung Jüdisches Museum Berlin. München: Hirmer 2025. 320 S., 250 Abb. in Farbe, Klappenbroschur, 21×26 cm.
Abb.: Tom Seidmann-Freud, Illustration für Die Fischreise, Tusche und Aquarellfarben auf Pergamentpapier, Berlin 1923. © The Collection of Tom’s Grandchildren

DBSM Leipzig: Forget it?!
bis 22. März 2026
Forget it?!
Zukünfte und Geschichten der Wissensspeicherung
Deutsches Buch- und Schriftmuseum
Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig
In Kooperation mit dem Deutschen Literaturinstitut Leipzig
Eine der größten menschlichen Errungenschaften ist die Speicherung von Wissen. Ohne sie wären kultureller und technischer Fortschritt undenkbar. Die neue Ausstellung Forget it?! Zukünfte und Geschichten der Wissensspeicherung im DBSM wagt eine «erinnerungskulturelle Zeitreise» und blickt zugleich in die Zukunft der Wissensspeicherung und deren wissenschaftliche Grundlagen.
Sie erzählt nicht nur von Hungersteinen, die im Mittelalter vor Dürrephasen warnten, und von den klassischen Archiven unseres Wissens, sie beleuchtet auch die existenziellen Fragen der Atomsemiotik, betrachtet Bioarchive, Asservatenkammern und Zeitkapseln sowie die ersten Versuche, Wissen etwa auf DNA zu speichern. – In einer Zeit, in der immer mehr digitale Daten in Millisekunden übertragen werden, stellt sich die Frage nach der Speicherung von Informationen so dringend wie nie zuvor: Was werden wir in hundert Jahren noch über uns wissen?
Zum Ausstellungsstart findet am Samstag, 8. November 2025, 10 bis 16 Uhr mit dem Tag des Vergessens – und der Erinnerung ein Mini-Festival statt. In Kooperation mit der Universität Leipzig, der Stadt Leipzig, den Wissensspuren e.V. sowie zahlreichen Partnern aus Wissenschaft, Kultur und Stadtgesellschaft stehen Workshops, Führungen, Vorträge und Spaziergänge auf dem Programm. Es geht um die Frage, wie wir erinnern wollen und was wir loslassen müssen, damit Neues entstehen kann.
Siehe auch: DBSM_Forget_it
Bild: 2014 lässt die Künstlerin Katie Paterson einen Wald pflanzen, um ihn 100 Jahre lang wachsen zu lassen. Aus seinem Holz entstehen anschließend Bücher, die im Laufe dieser hundert Jahre geschrieben werden. Die unveröffentlichten Manuskripte werden bis dahin in einer speziellen Bibliothek in Oslo verwahrt werden: der Future Library. Jedes Buch ist eine Zeitkapsel mit dem Auftrag, der Zukunft etwas über eine vergangene Gegenwart mitzuteilen. Foto: futurelibrary

Buch Wien 25
Buch Wien 25. Messe und Festival
12. bis 16. November 2025
Wiener Messegelände
Eröffnung am Mittwoch, 12. November, 17 Uhr
Buchmesse, Wissensfestival und Meinungsmarktplatz – mit diesen Schlagwörter wirbt die Buch Wien. Neu dieses Jahr: Die Bereiche Kinder- und Jugendliteratur sowie «Young Adult» ziehen in die neu erschlossene Halle C und bekommen erstmals einen eigenen Bereich für Bildungsmedien.
Die Eröffnungsrede der Buch Wien 25 hält Shila Behjat: «Das weibliche Gesicht des Wandel».
Die Bücherschätze der Antiquare von Inkunabeln bis zu zeitgenössischer Literatur finden Sie am Stand Nr. C01 (Verband der Antiquare).
Das Programm zum Download:
BW25-PH-WEB_3
Buch Wien 2024. Foto: © Bernhard Widmoser

Vormerken: Die Mainzer Buchwissenschaft präsentiert ihren Kalender für 2026/2027
6. November 2026
ab 17 Uhr
Druckladen, Gutenberg-Museum MOVED
Reichsklarastraße 1, 55116 Mainz
«Das kommt dabei heraus», wenn Studierende sich seit 2003 alle Jahre wieder zusammentun, um einen «Kalender über den Sinn des Lebens & alles zu machen»: also zwölf plus fünf typografisch gestaltete Blätter mit viel Hinter- und Tiefsinn …
Zur Ausstellungseröffnung sprechen Dr. Ulf Sölter, Direktor des Gutenberg-Museums Mainz, und Prof. Dr. Gerhard Lauer, Leiter der Abteilung Buchwissenschaft Johannes Gutenberg-Universität. Musik und Getränke gibt es ebenfalls.
Bild:
Vorab-Blättern auf der Frankfurter Buchmesse. Foto: Markus Kohz
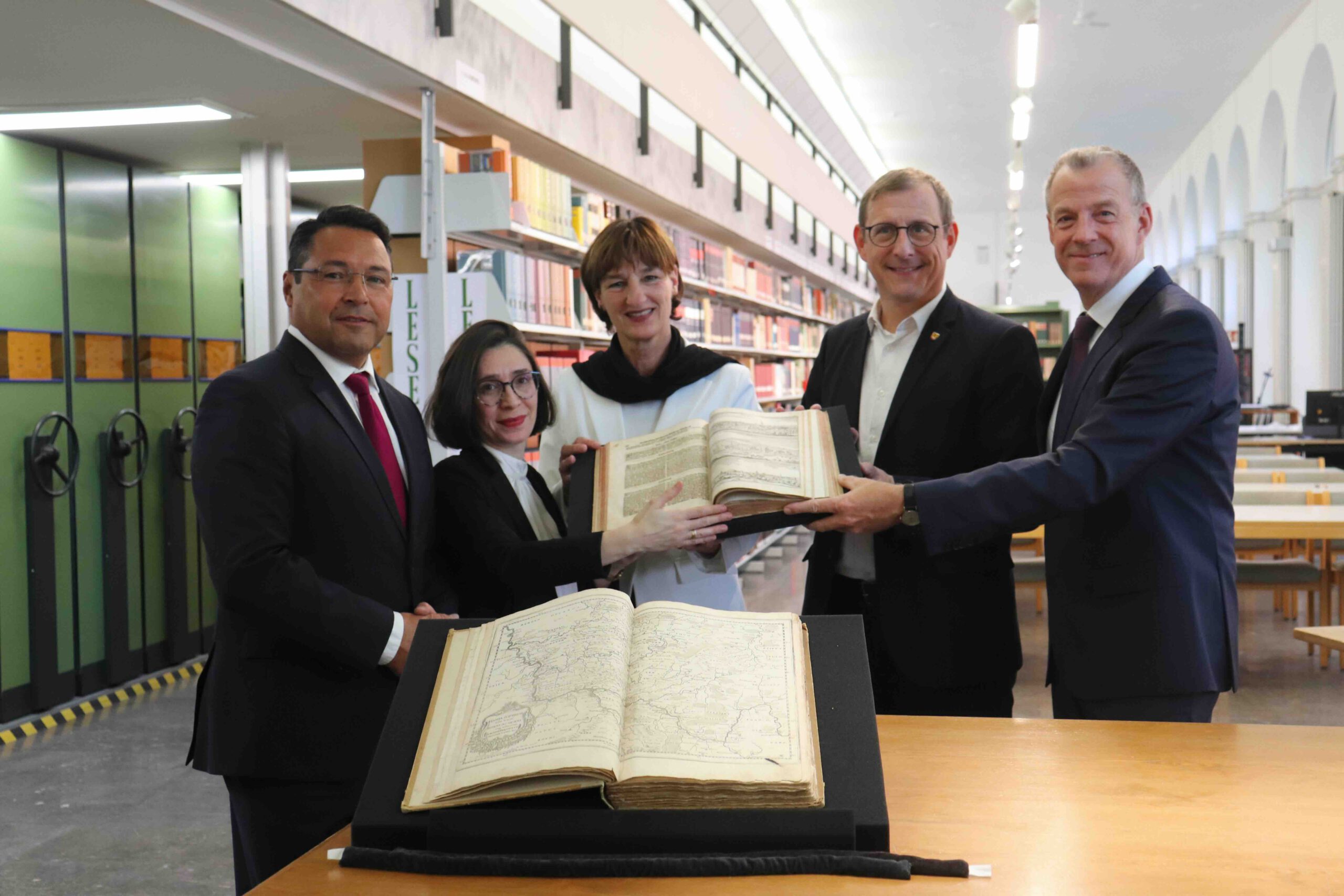
Zwei Druckwerke von Matthäus Merian d. Ä. fürs Gutenberg-Museum
Das Gutenberg-Museum hat zwei bedeutende Druckwerke von Matthäus Merian d. Ä. (1593–1650) als Dauerleihgabe erhalten, die das außergewöhnliche künstlerische Erbe des Kupferstechers und Verlegers widerspiegeln.
Es handelt sich dabei um die beiden Bände Topographia Palatinatus Rheni (Erstausgabe 1645) und Topographia Hassiae (zweite Auflage von 1655). Die Drucke wurden vermutlich 1661 von den Nachfahren Merians dem Gymnasium zu St. Katharinen Oppenheim geschenkt, als dies Schule ihr 100-jähriges Jubiläum feierte. Merian war nach Stationen in zahlreichen europäischen Städten zeitweise auch in Oppenheim, wo er beim Verleger Johann Theodor de Bry arbeitete und im Jahr 1617 dessen Tochter Maria Magdalena heiratete. 1650 starb Matthäus Merian, seine Nachkommen führten das Erbe weiter fort.
«Das Gutenberg-Museum besitzt einige Drucke von Merian. Anhand dieser besonderen Publikationen bekommt unsere Sammlung eine einzigartige Ergänzung. […] Merians Drucke haben den Anspruch, das Wissen über ausführliche Texte und Stadtansichten zu erweitern», so Museumsdirektor Dr. Ulf Sölter.
Das Gutenberg-Museum freut sich sowohl über die exklusive Provenienz als auch über die Möglichkeit, die Bände wissenschaftlich unter die Lupe zu nehmen und in künftige Projekte einzubeziehen. Sie werden unter vorgegebenen konservatorischen Bedingungen im Depot aufbewahrt.
Bild:
Feierliche Übergabe der zwei Bände in der Gutenberg-Bibliothek des Gutenberg-Museums, von links: Dr. Hendrik Förster (Schulleiter), Dr. Nino Nanobashvili (Kuratorin Gutenberg-Museum), Marianne Grosse (Bau – und Kulturdezernentin Stadt Mainz), Thomas Barth (Landrat), Dr. Ulf Sölter (Direktor Gutenberg-Museum).

Landesbibliothek Oldenburg: Rekonstruktion des als verschollen geltenden Werkes «Im Zeichen der Spinne» von Mopsa Sternheim
Eine literarische Sensation – Mopsa Sternheims (1905–1954) einziger Roman Im Zeichen der Spinne ist 71 Jahre nach ihrem Tod erschienen.
In einem altem Koffer mit der Adressierung «Madame D. de Ripper, 178 Bd. Hausmann, Paris 8e» (Sternheims Ehename und ihre letzte Wohnadresse in Paris) mit Briefen und hunderten von unsortierten Blättern offenbarte sich im Sommer 2023 das Manuskript des einzigen Romans von Mopsa Sternheim. Der Koffer aus dem Nachlass des in Oldenburg geborenen Kunsthistorikers Gert Schiff (1926–1990) war 2015 von der Gründerin der Stiftung Dr. Gert Schiff, Elfriede Loheyde, als Dauerleihgabe in die Landesbibliothek Oldenburg gegeben worden.
Für die Rekonstruktion des als verschollen geltenden Werkes werteten die Herausgeber Dr. Rudolf Fietz und Gisela Niemöller seit 2023 hunderte unsortierter Manuskriptblätter mit zahllosen Textvarianten aus.
Im April 2024 fanden Dr. Mona Halfmann und Dr. Christoph Halfmann (Oldenburg) fehlende Bausteine des Romans im Nachlass ihres Vaters bzw. Schwiegervaters Helmuth Steenken und stellten sie für das Editionsprojekt zur Verfügung. Diese Dokumente hat die Landesbibliothek Oldenburg nun von ihnen als Dauerleihgabe erhalten.
Die kommentierte Lesefassung des Romans Im Zeichen der Spinne ist mit einem Nachwort der Herausgeber im Göttinger Wallstein Verlag erschienen und ab Mitte November 2025 wieder lieferbar.
Bild:
Dokumente aus dem Nachlass von Helmuth Steenken halfen bei der Rekonstruktion des Romans Im Zeichen der Spinne. Im Bild (v. l.): Bibliotheksdirektorin Corinna Roeder, Dr. Christoph Halfmann, Dr. Mona Halfmann, Dr. Rudolf Fietz. Foto: Annika Östreicher, LBO.

Einbandkunst: Prof. Mechthild Lobisch verstorben
Woher ihre Inspiration komme, wisse sie nicht, sagt Mechthild Lobisch in dem kleinen Film, der anlässlich der Verleihung des Oberbayerischen Kulturpreises 2013 gedreht worden ist (mlobisch_film2013). Bucheinband, Grafik und Zeichnung, dies sei einfach ihre «Art, sich im Leben zu artikulieren».
Als Viel- und Gerneleserin trete sie in einen Dialog mit der Literatur. Das Ergebnis ist aber nie Geschichten erzählende Illustration, sondern konkrete Kunst: Mit Form und Farbe neue Ordnungen zu erfinden, war das Ziel der Einbandkünstlerin Mechthild Lobisch. Sie suchte weder nach ausgefallenen Materialien noch nach technischem Raffinement: «Es geht allein um die formale Qualität, um das Buch als geistige Präsenz in plastischer Körperhaftigkeit.»
Dass das so tief in unserer Kultur verankerte Medium Buch verschwinden könnte, war für sie unvorstellbar; wohl aber sah sie, dass das handwerkliche Können verschwindet. Umso mehr freute sie sich darüber, dass einige ihrer Studentinnen sowohl mit handwerklicher wie auch künstlerischer Qualität zu überzeugen wissen. Gelehrt hat Mechthild Lobisch an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, wo sie von 1995 bis zu ihrem Ausscheiden 2006 im Fachbereich Kunst die Studienrichtung Konzeptkunst Buch lehrte – einzigartig in Deutschland – und 1997 das Otto-Dorfner-Institut gründete und leitete. Für das Institut gab sie 1999 den Katalog zur gleichnamigen Ausstellung Zwischen van de Velde und Bauhaus – Otto Dorfner und ein wichtiges Kapitel der Einbandkunst heraus, die in Kirchheim unter Teck, Weimar und Mariémont in Belgien gezeigt wurde. – Bevor sie dem Ruf an die «Burg» folgte, hatte sie schon an der Akademie für Gestaltung und Design der Handwerkskammer München/Obb. unterrichtet.
Geboren 1940 in Hirschberg (Schlesien), machte Mechthild Lobisch zunächst eine Buchbinderlehre. Zu den weiteren Stationen gehören unter anderem der dreijährige Aufenthalt in Paris, wo sie französische Sprache, Literatur und Kunstgeschichte an der Sorbonne studierte sowie Einbandentwurf, Einbandgeschichte und Dekorationsvergolden an der Ecole Estienne; danach Studium an der Folkwangschule für Gestaltung als Meisterschülerin, seit 1978 freischaffende bildende Künstlerin.
«Das künstlerische Wollen findet immer seinen Weg», davon war Mechthild Lobisch überzeugt. Am 30. September 2025 ist sie nun im Alter von 84 Jahren gestorben.
Foto: Thomas Schuster

FBM 2025 Nachlese – «Ich drucke!»
Ein weiteres Buch wurde am Buchmesse-Stand der Gutenberg Stiftung, der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft zu Mainz und des Gutenberg-Museums präsentiert:
Ich drucke! Signet, Marke und Druckerzeichen seit dem Zeitalter Gutenbergs. Herausgegeben von Hui Luan Tran und Nino Nanobashvili. Gebunden, 192 Seiten, Berlin: Deutscher Kunstverlag 2025. 48 €.
Der Band erscheint zur Ausstellung, die am 27. November 2025 im Gutenberg-Museum eröffnet wird. Anlässlich des 625-jährigen Geburtstages von Gutenberg widmet das Museum der Bildgattung der Druckerzeichen dann erstmals eine Ausstellung. Der Begleitband eröffnet mit Texten zu den Prozessen in der Druckwerkstatt und mit konkreten Fallbeispielen einen Zugang zur Welt der Drucker:innen und Verleger:innen von den Anfängen des Buchdrucks bis heute. Bemerkenswert schön ist auch die Gestaltung des Bandes.
Erschienen schon vor Ausstellungsbeginn und exklusiv auf der Buchmesse vorgestellt, ist der Band jetzt erst wieder ab dem 27. November erhältlich. Infos zur Ausstellung hier: GM_Ausstellung_Druckerzeichen
Vorbestellungen sind möglich unter:
Buch_Druckerzeichen
Auch dieses Buch wird ausführlich vorgestellt werden, online sowie in der Wandelhalle 2026-1.
Freuen sich über das fertige Buch, von links: Nicole Schwarz (De Gruyter), Andreas Koch (Gestaltung, Satz und Layout), Hui Luan Tran (Johannes Gutenberg-Universität, Mitherausgeberin), Katja Richter (Deutscher Kunstverlag, Leiterin des Verlags und Autorin), Imke Wartenberg (Deutscher Kunstverlag, Projektleitung), Nino Nanobashvili (Kuratorin Gutenberg-Museum, Mitherausgeberin). Foto: Markus Kohz

FBM 2025 Nachlese – Buchdruck in Europa und Asien
«Gemeinsam für Gutenberg» – so lautet das Motto der Gutenberg Stiftung, die zusammen mit der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft zu Mainz und dem Gutenberg-Museum einen großen Stand auf der Frankfurter Buchmesse hatte und hier viel Publikum anlockte. Am Buchmessen-Mittwoch gab es sogar zwei Buchpremieren, zum einen wurde präsentiert:
Cornelia Schneider und Volker Benad-Wagenhoff: Type. Buchdruck in Europa und Asien. Herausgegeben von der Gutenberg Stiftung und der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft in Mainz e. V. Wiesbaden: Harrassowitz 2025. 190 Seiten. 38 €.
Im Herbst 2018 war im Gutenberg-Museum die Ausstellung Ohne Zweifel Gutenberg? zu sehen gewesen. Erstmals wurden hier die Besonderheiten der asiatischen und der europäischen Drucktradition gezeigt und erläutert. Die Unterschiede sind so gravierend wie spannend.
Dank des unermüdlichen Einsatzes von Zvjezdana Cordier, Geschäftsführerin der Stiftung, konnte das zur Ausstellung geplante Buch nun doch noch erscheinen. Dank geht vor allem auch an das Autorenteam, an Salzer Papier, Peyer Cover und das Memminger MedienCentrum, die die Produktion gesponsert haben, an den Gestalter Dan Reynolds, an viele weitere Förderer und nicht zuletzt an den Verlag Harrassowitz, der dieses wichtige Buch zu einem bezahlbaren Preis in sein Programm aufnahm.
Eine ausführliche Vorstellung wird online sowie in der Wandelhalle 2026-1 erscheinen
Frisch zur Frankfurter Buchmesse erschienen: Type. Buchdruck in Europa und Asien. Foto: Markus Kohz
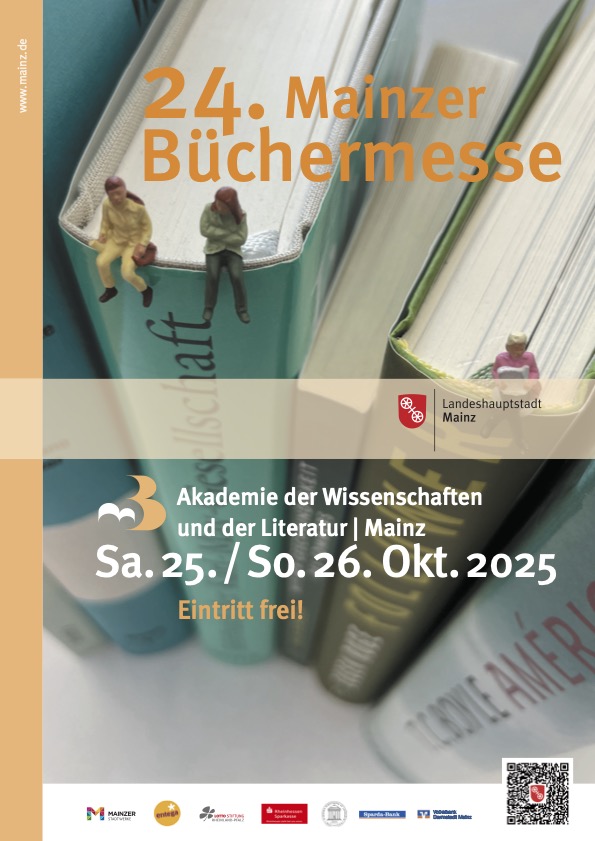
Mainzer Büchermesse 2025
24. Mainzer Büchermesse
25. und 26. Oktober 2025
in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur
Geschwister-Scholl-Straße 2, 55131 Mainz
Eintritt frei!
Leselust trifft auf Bücherliebe. Zwischen bewährten Klassikern und druckfrischen Geschichten präsentiert sich die regionale Buchszene aus Mainz und der Umgebung wieder von ihrer besten Seite: Die 24. Mainzer Büchermesse lädt ein, sich ein Wochenende lang auf eine inspirierende Reise durch die Welt der Worte zu begeben.
Digitaler Flyer zum Download:
Digitaler-Flyer-Mainzer-Bu-chermesse-2025
Das Plakat zur Büchermesse.
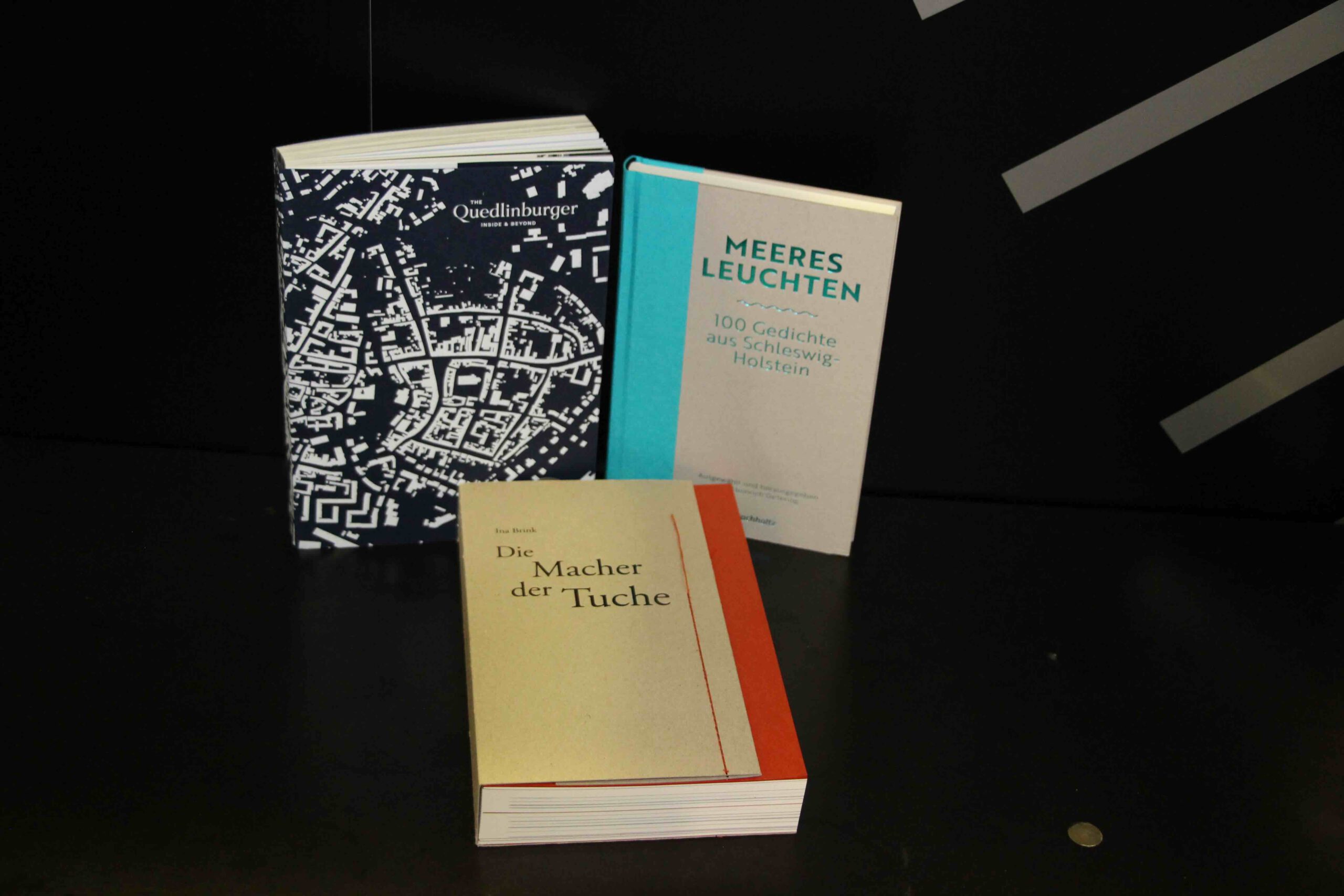
FBM 2025 Nachlese – Stiftung Buchkunst: Schönste Regionalbücher
Ein besonderes Schmankerl am Stand der Stiftung Buchkunst war die Live-Jurysitzung zu Deutschlands Schönstem Regionalbuch. Die fünfköpfige Jury – Dr. Matthias Grüb (8 grad verlag), Kristine Harthauer (SWR Kultur Audio), Ernst Georg Kühle (kühle und mozer / grafische entwerfer), Elena Ratkowitz (Umstädter Bücherkiste), Anja Wolsfeld (Offsetdruckerei Karl Grammlich) – diskutierte öffentlich über die insgesamt 15 nominierten Bücher und stimmte zum Schluss ab. Die Gewinner:
Kategorie Sachbuch/Ratgeber:
Die Macher der Tuche von Ina Brink, erschienen im Eigenverlag.
Aus der Begründung des Jurymitglieds Ernst Georg Kühle: «Die Macher der Tuche ist ein kongeniales Gesamtkunstwerk. Die multitalentierte Autorin ist zugleich Familienchronistin, Gestalterin, Setzerin, Herausgeberin und Verlegerin in Personalunion. Die sorgfältigst produzierte Publikation ist sowohl eine inhaltliche als auch grafische und haptische Delikatesse.»
Kategorie Touristische Entdeckung:
The Quedlinburger von Anna Fulton-Schwindack, Katharina Schwindack und Anselm Schwindack, erschienen bei The Quedlinburger.
Aus der Begründung des Jurymitglieds Kristine Harthauer: «Die Offenheit, mit der die Stadt präsentiert wird, zeigt bereits die elegante offene Bindung. Das Buch […] und zieht einen direkt in seinen Bann. Auch ist es trotz seiner kompakten Form überraschend leicht. […] Auf festem, hochwertigem Papier finden wir zahlreiche Fotografien, die mit ihrer warmen Farbigkeit und vielen Detailaufnahmen Intimität erzeugen. Auf gelben Seiten gedruckte Rezepte wie für den ‹Münzenberger Muskuchen› und ein leuchtend gelbes Lesezeichen, das gleichzeitig als Inhaltverzeichnis dient, runden die Gesamtkomposition ab.»
Kategorie Literatur/Belletristik:
Meeresleuchten von Heinrich Detering (Herausgeber), erschienen im Wachholtz Verlag.
Aus der Begründung des Jurymitglieds Anja Wolsfeld: «Meeresleuchten zeigt auf poetische Weise die Vielfalt Schleswig-Holsteins, von der stürmischen Nordsee hin zu verwunschenen Buchten an der Ostsee. Der Kontrast zwischen der glitzernden Wasseroberfläche im Sonnenschein und der rauen See wird durch die Einbandgestaltung selbst gekonnt umgesetzt – unbezogene raue Graupappe trifft auf eine Heißfolienprägung in blau metallic. Die ausgewogene Umsetzung setzt sich im Inhalt fort: viel Weißraum trifft auf moderne serifenlose Typografie für Titel und Autor:in eines jeden Gedichts, während die Verse und Strophen selbst in einer klassischen Serifenschrift gesetzt sind.»
Ziel des gemeinsam vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Stiftung Buchkunst ausgelobten Wettbewerbs ist es, die Vielfalt regionaler Bücher ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und Verlage darin zu bestärken, auch bei Regionaltiteln beste Qualität zu publizieren.
Die drei gekürten Regionalbücher. Foto © Ronja Ferkinghoff

FBM 2025 Nachlese – Stiftung Buchkunst: Vom Bild zum Buch
Der Stand der Stiftung Buchkunst auf der Frankfurter Buchmesse ist Anlaufstation für alle, die sich für die vorbildliche, aktuelle Buchproduktion interessieren. Blättern kann man nicht nur in den als Schönste deutsche Bücher 2025 ausgezeichneten Titeln, sondern auch in den Büchern der Short- und der Longlist. Ebenso lockt ein Vergleich mit dem Wettbewerb Best Book Design all over the World.
Am Messe-Donnerstag gab es außerdem Vorträge und Gespräche, etwa zu den Themen World Design Capital Frankfurt RheinMain 2026: Was kann Design schon ausrichten? (der gleichnamige, zweisprachige Reader ist bei avedition, Stuttgart erschienen) und Salzer Papier & Stiftung Buchkunst: Schöne Bücher und deren Langlebigkeit.
Von den angekündigten zwei Illustratorinnen fehlte Katrin Stangl leider krankheitsbedingt. Aus dem Dialog wurde ein Solo für Sabine Kranz. Sie gab einen anschaulichen Einblick in die Entstehung ihres bei kunstanstifter erschienenen und von der Stiftung Buchkunst ausgezeichneten Kochbuchs Gemüsefreunde. Statt Hochglanz-Foodfotografie begleiten ihre herrlichen Illustrationen die fleischfreie Rezeptesammlung aus dem Freundeskreis; gedruckt sind sie auf schmeichelweiches Werkdruckpapier von der Gutenberg Beuys Feindruckerei in mineralölfreien Sonderfarben, also rasterfrei. Das ist etwas Besonderes! So sind nicht nur die Rezepte ein Genuss, sondern auch die Gestaltung des Buches, zu der auch ein Kapitalband und ein Lesebändchen gehören, beides violett wie eine Aubergine.
Von links: Birte Kreft (Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst), Maria Figura (Gutenberg Beuys) und Sabine Kranz, die Autorin und Illustratorin, mit Druckbogen. Foto: Carolin Bloeink

FBM 2025 Nachlese – Ehrengast Philippinen: «Pinupuno ang hangin ng hiwatig»
Die Philippen waren Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2025. Die Übersetzung des in der Überschrift zitierten Ehrengast-Mottos in Filipino lautet auf Deutsch «Fantasie beseelt die Luft».
Im Ehrengast-Pavillon war dieses Motto luftig-leicht und minimalistisch in Szene gesetzt: Der Designer Stanley Ruiz hat sieben «Inseln» entworfen, gebaut aus Bambus, Stahl und Textilien mit drachenähnlichen ‹Dächern› aus lichtdurchlässigen Membranen, belebt durch Bücher und Projektionen zeitgenössischer Künstler:innen. Sie präsentieren unter anderem das Werk des Freiheitskämpfers, Nationalhelden und Dichters José Rizal (1861–1896) sowie aktuelle Werke nationaler Schriftsteller:innen, nicht zuletzt die philippinische Geschichte, die geprägt ist durch 300 Jahre spanische Herrschaft und die ab 1898 fast 50 Jahre währende amerikanische Kolonialzeit. Am 4. Juli 1946 wurden die Philippinen zumindest formal in die Unabhängigkeit entlassen. Gewaltherrschaft, Korruption und politische Morde durch Diktatoren wie Ferdinand Marcos und Rodrigo Duterte sind bis heute Thema zeitgenössischer Literatur.
Gefeiert wurde demgegenüber die kulturelle Ausdruckskraft der philippinischen Literatur, die verwurzelt ist in mündlichen Überlieferungen und indigenen Traditionen und zugleich geprägt bleibt von Kolonialgeschichte und politischen Kämpfen. Auf den über 7641 Inseln der Philippinen leben gegenwärtig 109 Millionen Menschen, die 135 ethnolinguistischen Gruppen angehören und 183 Sprachen sprechen und jede «trägt ihre eigene Weltanschauung und Klangfarbe in sich».
Rund 30 deutschsprachige Verlage haben im Rahmen des Ehrengastprogramms inzwischen philippinische Literatur in Übersetzung und Bücher über die Philippinen herausgebracht. Herausgegriffen seien nur Killing Time in a Warm Place und Last Call Manila von Jose Dalisay, Überreste von Daryll Delgado, Gagamba der Spinnenmann und PO-ON: Die Quelle oder wie alles begann von F. Sionil José, Die Kollaborateure von Katrina Tuvera und die viel diskutierte, bedrückende Reportage Some People Need Killing. Eine Geschichte der Morde in meinem Land von Patricia Evagelista.
Hier eine Übersicht zum Download: 2025_Neuerscheinungen Philippinen
Orte für Lektüre, Reflexion und Austausch. Foto: Silvia Werfel

Serafina Nachwuchspreis für Illustration 2025 an Hannah Brückner
Die Künstlerin Hannah Brückner wurde für ihr 2025 bei NordSüd, Zürich, erschienenes Bilderbuch Kolossale Katastrophe mit dem Serafina Nachwuchspreis für Illustration ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Frankfurter Buchmesse am Stand der Gutenberg Stiftung statt.
Neben Hannah Brückner waren Paulina Rauh mit OH NEIN! (kunstanstifter 2025), Rebekka Stelbrink mit Stille Post (Bohem Press 2025), Magali Franov mit Zuhause auf der Klippe (Edition Nilpferd 2025) und Ca Rose mit Und jetzt sei fröhlich, Knochenmann! (kunstanstifter 2024) mit ihren Büchern nominiert.
Der Preis wird von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur 2025 ausgelobt, in Kooperation mit der Frankfurter Buchmesse und dem Börsenblatt und gestiftet von der Mediengruppe Pressedruck. Die Giraffenfigur ist ein Entwurf der Aschaffenburger Künstlerin Luise Terletzki-Scherf für die Porzellan Manufaktur Nymphenburg.
Die Serafina-Preisträgerin Hannah Brückner. Foto: Anja Schnell, Team Momentesammler
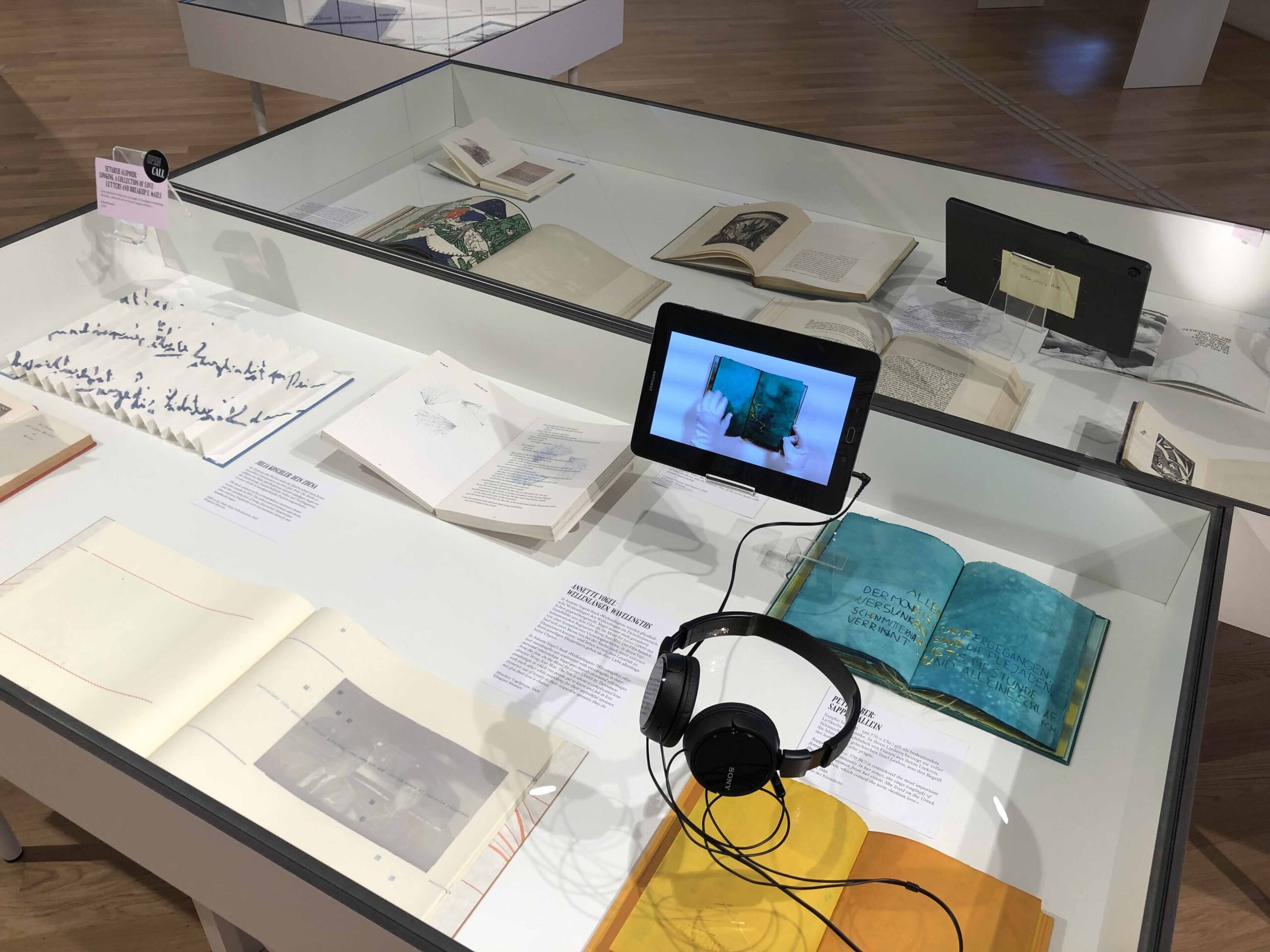
Klingspor Museum: Love Stories zum Dritten …
bis 16. November 2025
Love Stories.
Der Anfang, das Ende und alles dazwischen
Klingspor Museum, Herrnstraße 80, 63065 Offenbach
Trauer, Verlust, Schmerz, Gewalt – auch das sind Facetten der Liebe. Ihnen widmet sich das Klingspor Museum mit Künstlerbuchunikaten, Installationen und historischen Buchausgaben aus dem eigenen Bestand. Darunter sind bibliophile Kostbarkeiten mit Illustrationen von Oskar Kokoschka, Hugo Steiner-Prag, Max Liebermann und Frans Masereels Geschichte ohne Worte; ihnen gegenüber etwa Petra Obers Sappho. Allein, eine Leihgabe der Künstlerin. Erinnerungen an Verstorbene wecken die nach Porzellanbildern auf einem Friedhof gefertigten und von der Decke hängenden Objekte in Sára Richters Potpourri und Sandra Heinz hat Fragmente von Liebesbriefen ihrer Eltern zwischen Gazelagen verklebt und eingenäht, als großes Wandbild, das verhüllt und zugleich schützt.
Ebenfalls zu sehen: der Film The Great Wall Walk. Hierin laufen Marina Abramovic und ihr langjähriger Partner Ulay von unterschiedlichen Richtungen auf der Chinesischen Mauer aufeinander zu. Nach drei Monaten trafen sie aufeinander – anstatt wie geplant zu heiraten, trennten sie sich nach der Begrüßung.
Künstlerbuchunikate von Petra Ober und Annette Vogel. Foto: Silvia Werfel

Offenbach: Love Stories zum Zweiten …
bis 16. November 2025
Love Stories.
Der Anfang, das Ende und alles dazwischen
Haus der Stadtgeschichte, Herrnstraße 61, 63050 Offenbach
Im großen Ausstellungsraum im Haus der Stadtgeschichte kann man der ersten Verliebtheit nachspüren, der romantischen Liebe, dem Werben um die Angebetete einst und jetzt – in Wandtexten, Installationen, Fotos und Hochzeitsalben aus Familienbesitz sowie Künstlerbüchern, etwa von Sandra Heinz, Barbara Beisinghoff, Thomas Bayrle. Auch zu sehen: die geschwungene Handschrift namens Conspired Lovers / Heimliche Liebhaber, entworfen von dem Typografen Harald Geisler, der an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert hat.
Blick in die Ausstellung. Foto: Silvia Werfel
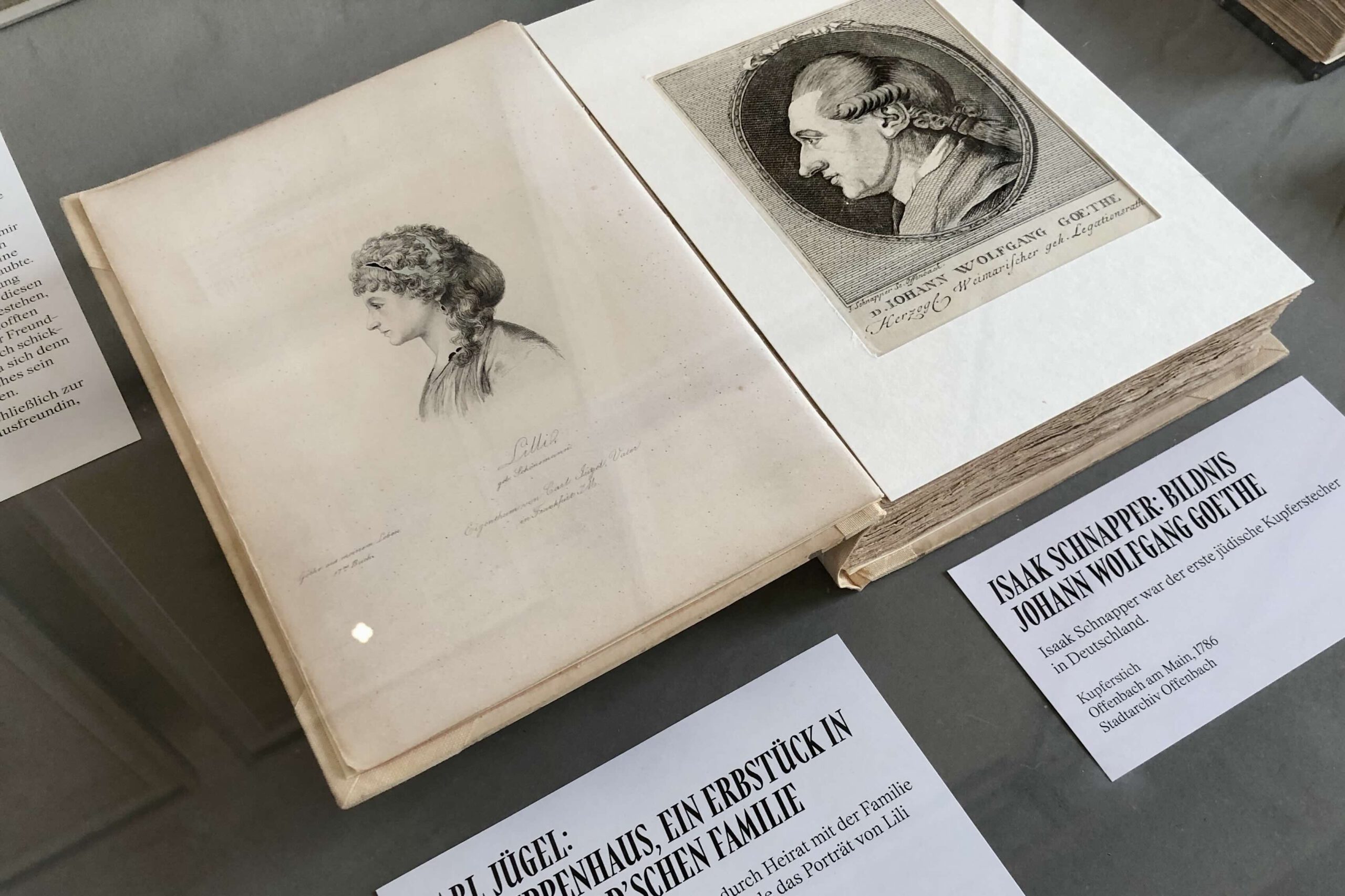
Offenbach: Love Stories zum Ersten …
bis 16. November 2025
Love Stories.
Der Anfang, das Ende und alles dazwischen
Haus der Stadtgeschichte, Herrnstraße 61, 63050 Offenbach
Impuls für diese ganz besondere Jubiläumsausstellung ist eine Offenbacher Verlobung vor 250 Jahren: Um Johann Wolfgang Goethe und Elisabeth (Lili) Schönemann kreisen die Exponate in dem Raum, der im Haus der Stadtgeschichte eigentlich Alois Senefelders Erfindung der Lithografie gewidmet ist. Besonders hervorgehoben seien hier zwei selten gezeigte Goethe-Bildnisse, ein Ölgemälde und ein Kupferstich.
Der Offenbacher Porträtmaler Georg Oswald May (1738–1816) malte 1769 den jungen Goethe; von dem verschollenen Original gibt es nur noch eine Kopie von 1779, die im Museum für Gießen hängt. Als Leihgabe fand sie nun den Weg zur Jubiläumsschau nach Offenbach.
Relativ selten ist der Kupferstich des in Offenbach tätigen jüdischen Künstlers Isaak Schnapper aus dem Jahr 1786. Es handelt sich um die Kopie eines Stichs von Daniel Chodowiecki (1726–1801), der wiederum nach einer Zeichnung des mit Goethe befreundeten Weimarer Malers Georg Melchior Kraus (1737–1806) im Jahr 1776 entstanden ist. Drei Wochen vor Ausstellungseröffnung konnte der Druck über das Berliner Auktionshaus Nosbüsch & Stucke fürs Haus der Stadtgeschichte angekauft werden.
Seltener Fund: das Kupferstich-Porträt von Goethe im Format 14,8×12,8 cm von Isaak Schnapper. Foto: Silvia Werfel

Bamberg: Ausstellung zu Jean Pauls 200. Todestag
bis 13. Dezember 2025
«Meine Feder soll ein Flügel sein»
Jean Paul und seine literarischen Netzwerke.
Staatsbibliothek Bamberg
Neue Residenz, Domplatz 8, 96049 Bamberg
Anlässlich des 200. Todestags des oberfränkischen Schriftstellers Jean Paul, der 1763 in Wunsiedel geboren wurde, präsentieren die Staatsbibliothek Bamberg und die Landesbibliothek Coburg zwei aufeinander bezogene Ausstellungen mit jeweils eigenen Akzenten.
Im Mittelpunkt der Bamberger Ausstellung stehen ausgewählte Briefe, die Jean Paul an den jüdischen Handelsherrn Emanuel Osmund (1766–1842) richtete. Seit 2010 bewahrt die Staatsbibliothek Bamberg als Dauerleihgabe der Oberfrankenstiftung mehr als 1100 Briefe und Billets Jean Pauls.
Der jahrzehntelange Austausch der beiden Freunde wird in der Bamberger Ausstellung in einen größeren Rahmen eingebettet. Graphiken und Erstausgaben seiner Werke illustrieren Jean Pauls Entwicklung zu einem Erfolgsautor. Aufmerksamkeit gilt auch Jean Pauls Kontakten zur Bamberger Literaturszene. Präsentiert werden daneben moderne illustrierte Ausgaben und Künstlergraphiken, die heutigen Lesern neue Zugänge zu Jean Pauls bildgewaltigen Erzählungen erschließen.
Zur Ausstellung ist eine bebilderte Begleitpublikation erschienen:
Meine Feder soll ein Flügel sein. Jean Paul und seine literarischen Netzwerke. Hrsg. von Helmut Pfotenhauer, Sascha Salatowsky und Bettina Wagner. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2025 (Bamberger Buch-Geschichten Nr. 5). 30 €.
Hier der Flyer zum Download:
JeanPaul_2025_StaatsbibliothekBamberg Flyer
Dieser Link führt zur Ausstellung in Coburg:
Jean_Paul_Coburg
Abbildung: «Meine Feder sol heute ein Flügel sein.» Jean Paul. Farbstiftzeichnung von Stephan Klenner-Otto. Gnailes, Rödental, 2025 | SBB, I T 83c/19

Die Gesellschaft der Bibliophilen e.V. trauert um Prof. Dr. Hansgeorg Schmidt-Bergmann
Ein Nachruf von Sebastian Eichenberg
Glück und Verstand – Minutenlektüren von Johann Peter Hebel lautet der Titel eines kleinen Büchleins, welches uns Hansgeorg Schmidt-Bergmann am 3. Juni 2018 auf der Jahrestagung in Freiburg beim Festabend schenkte. Es war ursprünglich eine Jahresgabe der Literarischen Gesellschaft/Scheffelbund 2010, welche Schmidt-Bergmann zusammen mit Franz Littmann bei Hoffmann und Campe herausgegeben und mit einem Nachwort versehen hat.
Dort heißt es: «Die Auswahl des vorliegenden Bandes versucht eine Antwort abseits der heute überlebten konventionellen Denkweisen. Mit Verstand glücklich werden hieß ja für Hebel […] nichts anderes als die Kunst, die Lebenskräfte durch eine Vergegenwärtigung des Todes zu stärken. Gleichberechtigt neben der ‹ars moriendi› findet der Leser zahlreiche Aufforderungen zur ‹ars vivendi›, deren Horizont die Gelassenheit und die Zufriedenheit mit sich und der Welt bilden.» Laut Hebel muss man beides können: Sich um die Zukunft sorgen, als auch sorglos in der Gegenwart leben, und – das Wichtigste dabei – seinen Humor und seine Heiterkeit nicht verlieren. Es allen recht zu machen, kann nicht gelingen.
Wenn Hansgeorg Schmidt-Bergmann seine Ehefrau, unsere Erste Vorsitzende Dr. Annette Ludwig, jährlich zu den Jahrestagungen begleitete, konnte man genau dieses Motto immer wieder bei ihm erleben. Gespräche, ernst in der Thematik, waren nie zynisch. Humorvolle Stunden wurden nie zum Unsinn. Es schien so, als ob Hansgeorg Schmidt-Bergmann genau diese, eigentlich recht schwierige Art der «Lebenskunst», nämlich mit Hilfe des Verstandes glücklich werden, durchdrungen hatte. Eine im wahrsten Sinne des Wortes logische Sache, wenn man dabei sein umfangreiches literarisches Wissen und seine Erfahrungen als kluger Analytiker in der Literaturwissenschaft berücksichtigt. Seine Teilnahmen waren stets eine große Bereicherung für die Tagungen.
Doch beim näheren Kennenlernen offenbarte sich die Symbiose zwischen Verstand und vor allem Herz. Wenn er etwas fragte, tat er dies nicht aus Gefälligkeit, sondern weil es ihn wirklich interessierte. Seine Ratschläge und Anmerkungen waren nicht belehrend, sondern immer Angebote, seine Ansichten und Erfahrungen in die persönlichen Überlegungen mit einzubeziehen. Dabei blieb er stets empathisch, offen und nahbar. Mit dieser Art hat er damit den Kreis der Lebenskunst ganz im Sinne Hebels geschlossen. Dieses Beispiel an «ars vivendi», die vielen klugen, schönen und empathischen Gespräche werden fehlen.
Am 3. September 2025 ist Hansgeorg Schmidt-Bergmann nun im Alter von 69 Jahren für alle überraschend in Weimar gestorben. Unser Mitgefühl gilt unserer Ersten Vorsitzenden Frau Dr. Annette Ludwig sowie der gesamten Familie.
Foto: Andrea Fabry (mit freundlicher Genehmigung der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe)
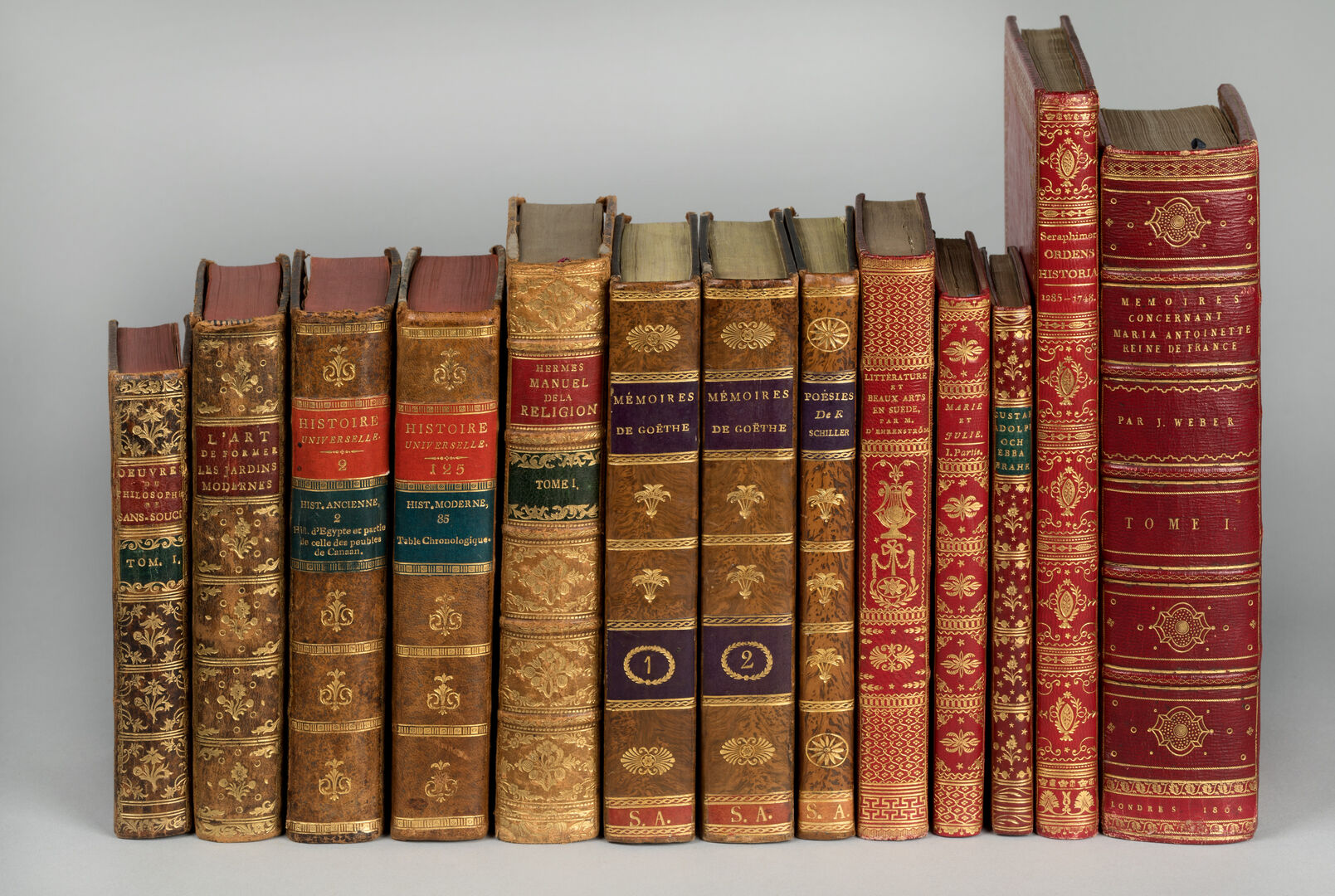
Schloss Rheinsberg: Die Prinzessinnenbibliothek
nur noch bis 5. Oktober 2025
Die Prinzessinnenbibliothek
Sofia Albertina von Schweden und ihre Bücher
Schloss Rheinsberg – Sommerappartement des Prinzen Heinrich
Schloss Rheinsberg 2, 16831 Rheinsberg
Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) präsentiert in Kooperation mit der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz erstmals öffentlich Höhepunkte aus der Privatbibliothek von Prinzessin Sofia Albertina von Schweden (1753–1829), der Tochter von Königin Luise Ulrike von Schweden (1720–1782) und damit eine Nichte des preußischen Königs Friedrich der Große (1712–1786).
Die rund 4500 Bände umfassende Bibliothek der Prinzessin wurde 2017 gemeinsam von der SPSG und der Staatsbibliothek zu Berlin erworben – großzügig unterstützt durch die Rudolf-August Oetker-Stiftung und die Kulturstiftung der Länder. Die vollständig erhaltene Sammlung ist ein außergewöhnliches Beispiel weiblicher Bildungsgeschichte und Lesekultur der Aufklärung.
Die Sonderausstellung zeigt 116 ausgewählte Bände und thematisiert unter anderem Bildung und Spracherwerb, Theater, Kunst, Architektur, Modejournale sowie Bücher als Zeichen von Wertschätzung und Repräsentation.
Der historische Ausstellungsort verleiht der Präsentation eine zusätzliche Tiefe: Im Bibliothekszimmer von Prinz Heinrich von Preußen – Bruder Friedrichs des Großen und Onkel Sofia Albertinas – wurde mit maßgefertigter Möblierung durch den Berliner Möbeldesigner Jonas Stürzebecher eine neue Ausstellungssituation geschaffen.
Bild:
Bücher aus der Privatbibliothek der Prinzessin Sofia Albertina von Schweden. © Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz / Carola Seifert

Klingspor Museum: Love Stories
bis 16. November 2025
Love Stories.
Der Anfang, das Ende und alles dazwischen
Klingspor Museum, Herrnstraße 80, 63065 Offenbach
Haus der Stadtgeschichte, Herrnstraße 61, 63050 Offenbach
Vor 250 Jahren verliebte sich der junge Johann Wolfgang Goethe in Elisabeth (Lili) Schönemann, die als kurzzeitige Verlobte Goethes in die Literaturgeschichte einging. Anlass genug, um über die Liebe neu nachzudenken. Dieses scheinbar universelle Gefühl zwischen Menschen ist Gegenstand zahlreicher literarischer und wissenschaftlicher Texte, es wird in Liedern besungen und in der Kunst verhandelt. Unterschiedliche Beziehungskonzepte und Gemeinschaften werden auf ihre Tragfähigkeit befragt und sind Gegenstand einer Doppel-Ausstellung im 250. Jahr der Liebe zwischen Goethe und Lili, der sechzehnjährigen Bankierstochter.
Eröffnet wurde sie am 22. August bei schönstem Spätsommerwetter im Hof des Büsing Palais. Während im Haus der Stadtgeschichte die beginnende Liebe im Fokus steht, widmet sich das Klingspor Museum dem Ende der Liebe mit allen Aspekten von Abschied, Enttäuschung, Herzschmerz und Neuanfang.
Neben eigenen Beständen der Museen sind zahlreiche Leihgaben zu sehen von Menschen, die dem Open Call der Museen gefolgt sind und die Ausstellung mit sehr persönlichen Artefakten, eigenen Texten und künstlerischen Arbeiten zu den Themen des Verliebtseins, Kennenlernens aber auch Trauer, Verlust und Schmerz bereichern.
Dr. Dorothee Ader, Leiterin des Klingspor Museums (am Mikro): Freude und Dank an das große und großartige Ausstellungsteam. Foto: © Markus Kohz
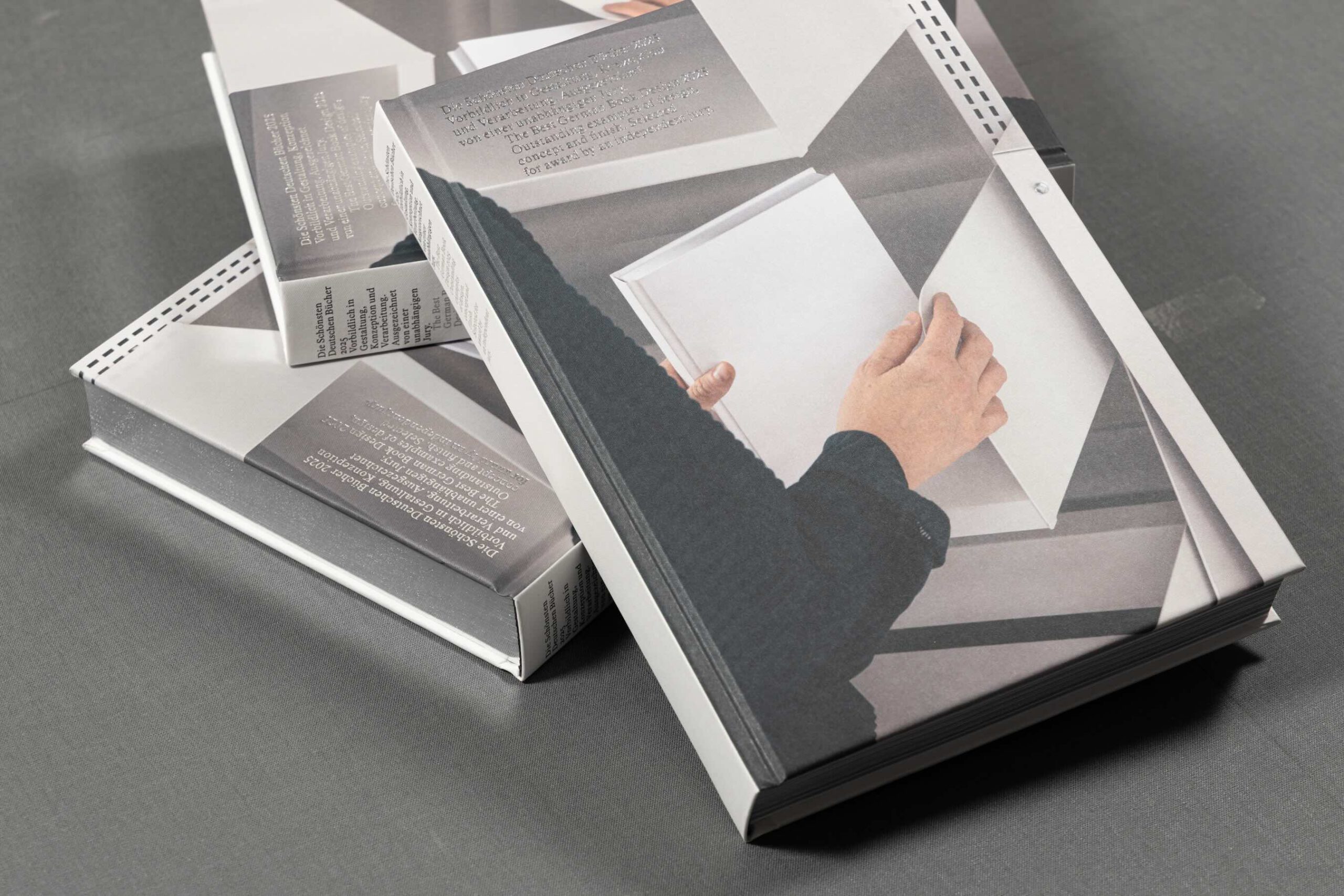
Katalog «Die schönsten deutschen Bücher 2025» erschienen
Pünktlich zur feierlichen Preisverleihung am 5. September 2025 im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main ist der Katalog Die Schönsten Deutschen Bücher 2025 erschienen. Konzipiert und gestaltet hat ihn das Studio Tillack Knöll – Design Practice, Stuttgart. Sven Tillack stellte das schöne Konzept des wunderbar ‹buchigen› Katalogs vor mit Fotos von Ann-Kathrin Müller, die den Umgang mit dem Buch feiern: Es beginnt mit dem Herausholen aus dem Archivregal, Hände halten es und blättern und stellen es zuletzt ins Regal zurück.
Bestellungen in der Lieblingsbuchhandlung (Preis: 20 €):
ISBN 978-3-9822108-4-1
Fotos: © Studio Tillack Knöll, Design Practice
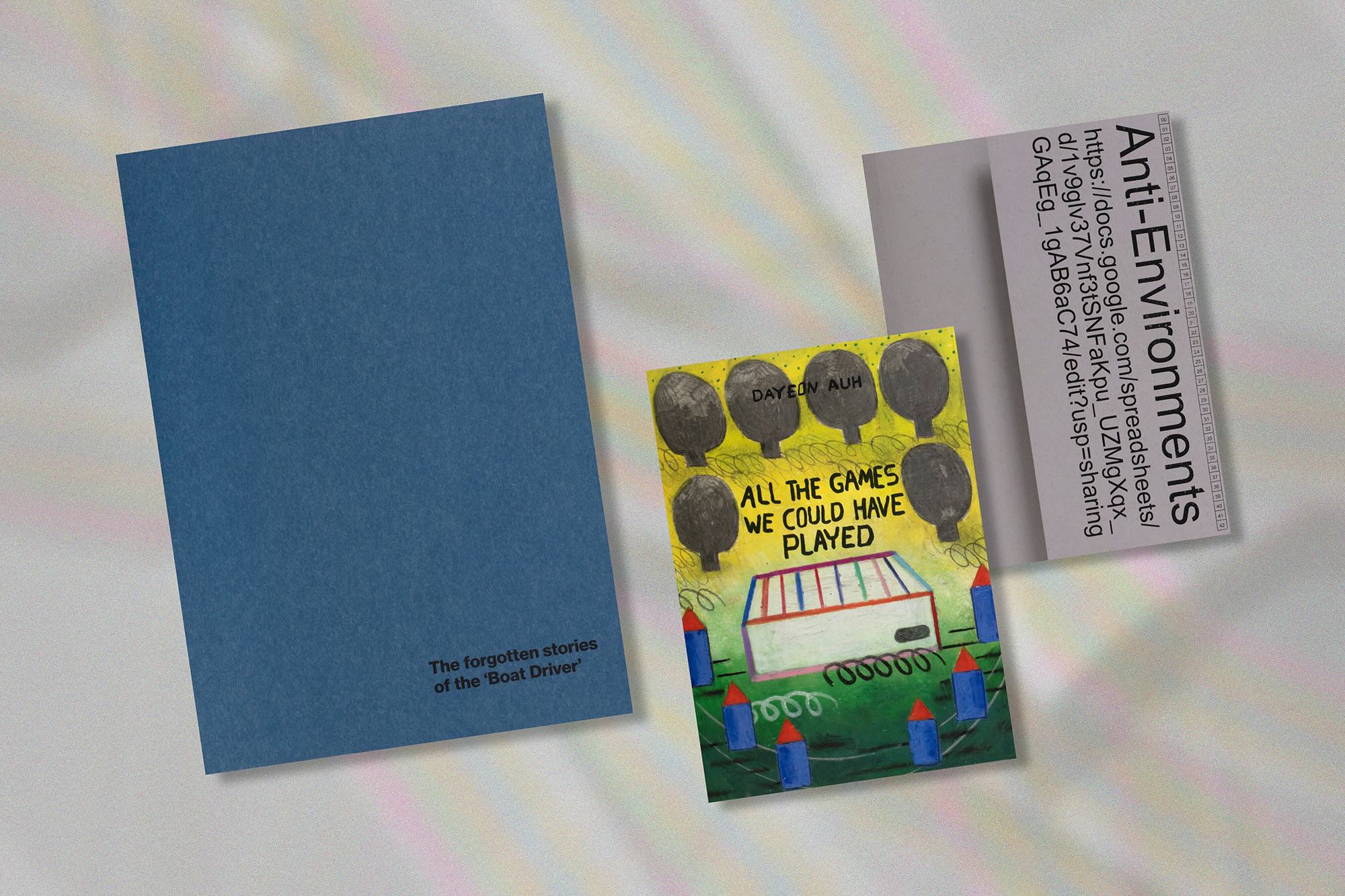
«Förderpreise für junge Buchgestaltung 2025» überreicht
Stiftung Buchkunst 2025
Für «besonders innovative, zukunftsweisende Konzepte zur gestalterischen Weiterentwicklung des Mediums Buch» vergibt die Stiftung Buchkunst alljährlich drei mit 2000 Euro dotierte Förderpreise. Im Jahr 2025, mit über 160 Einsendungen, gehen die Förderpreise an diese Titel:
Nora Börding, Anne Speltz
The forgotten stories of the ‹Boat Driver›
Eigenverlag
Dayeon Auh
All the Games WeCould Have Played
Eigenverlag
Luis Adrian Borchardt
Anti-Environments. Über das Erkunden von unkonventionellen Tools durch Friction und Norm-Bending
Eigenverlag
Faltblatt zum Download
fp25_praemierte_3:
Bildnachweis:
© Stiftung Buchkunst. Foto: Uwe Dettmar
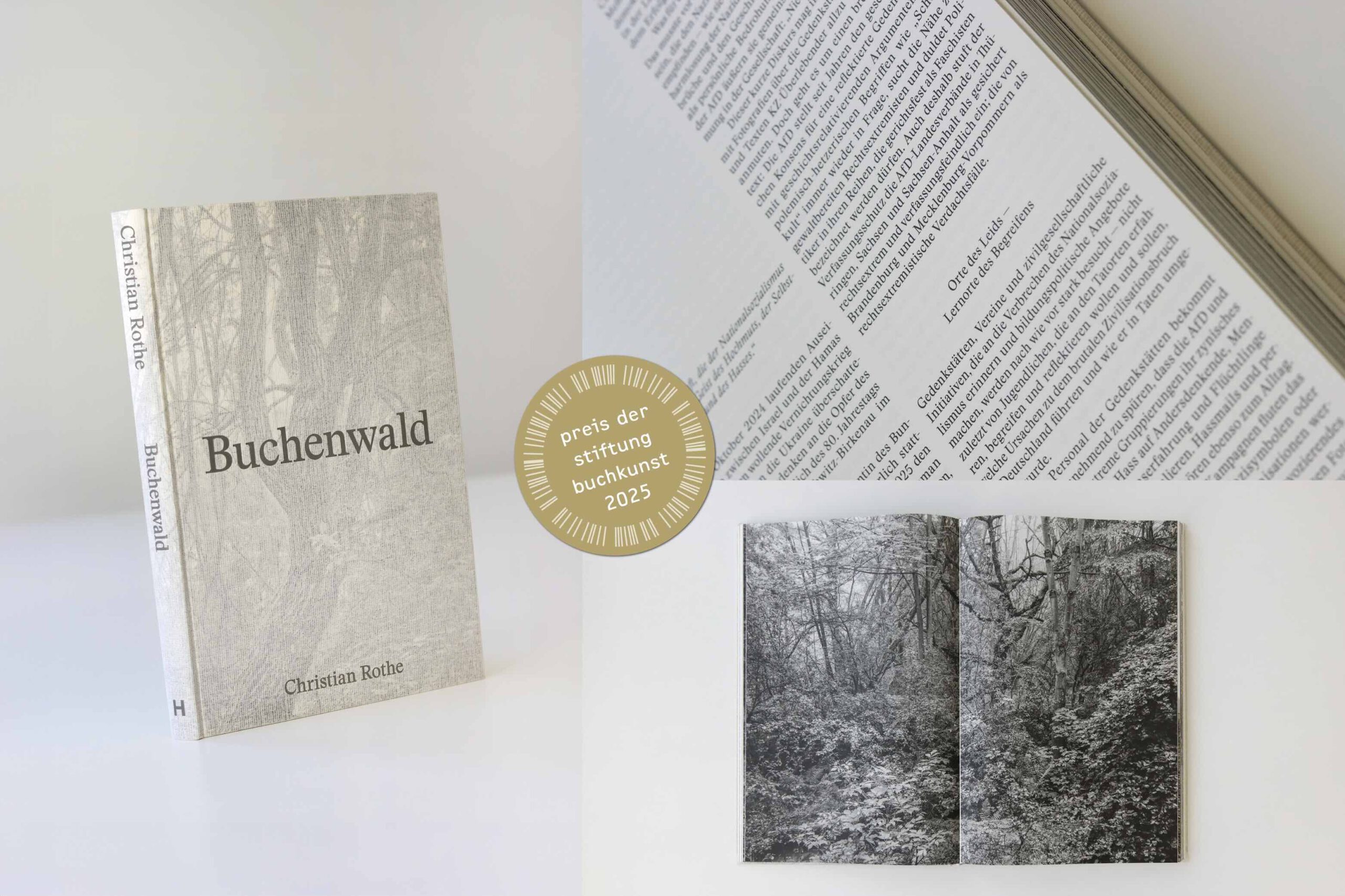
Preis der Stiftung Buchkunst 2025 geht an «Buchenwald», erschienen bei Hartmann Books
Am Freitagabend, den 5. September, wurden im Frankfurter Museum Angewandte Kunst die Preise für Die schönsten deutschen Bücher 2025 und die drei Förderpreise für junge Buchgestaltung überreicht. Auch das Geheimnis um den mit 10 000 Euro dotierten Preis der Stiftung Buchkunst wurde gelüftet: Er geht dieses Jahr an den Fotoband Buchenwald. Im Dickicht von Ettersberg, gestaltet vom Fotografen Christian Rothe, herausgegeben von Günter Jeschonnek und erschienen bei Hartmann Books, Stuttgart.
Im feierlichen Rahmen der Preisverleihung übergaben Birte Kreft, Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst, und Dr. Joachim Unseld, Verleger der Frankfurter Verlagsanstalt und Vorstandsvorsitzender der Stiftung, den Preis.
Aus dem Urteil der Jury: «Ein Buch voller Wucht und Würde, das durch eine eindringliche, respektvolle und mutige Annäherung an ein schreckliches Thema überzeugt. Das Eintauchen in eine so schwierige Thematik, die durch die feinfühlige Buchgestaltung überraschend zugänglich wird, gelingt bereits über das gazebezogene, reduzierte Cover. Hier entfaltet das mittig gesetzte und geprägte Wort Buchenwald eine starke Präsenz, während die spürbare Textur den Schatten der Bäume Dreidimensionalität verleiht.»
Die prämierten Bücher sind ab sofort in Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen, Termine hier:
Schönste2025_Wanderausstellung
Erstmalig eröffnet parallel zur Preisverleihung eine Ausstellung im chinesischen Hangzhou, organisiert von Hesign International. Auch die Kooperation mit dem Literaturhaus Frankfurt wird fortgeführt: Die 25 prämierten Bücher sind das ganze Jahr über im Foyer des Hauses zu sehen.
Mehr Infos zu allen gekürten Büchern gibt es hier:
Schönste_deutsche_Bücher_2025
Bildnachweis:
© Stiftung Buchkunst, Fotos: Carolin Blöink

Erinnerung an Otto Rohse
Am 2. Juli 1925 wurde Otto Rohse geboren, einer der bedeutenden deutschen Buchkünstler des 20. Jahrhunderts. Seine privat betriebene Otto Rohse Presse verkörperte das Ideal des Künstlers, der sämtliche Aspekte des Buches selbst gestaltet – vom Schriftsatz über Graphik, Papier und Druck bis hin zum Einband.
Geboren und aufgewachsen in Ostpreußen, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Hamburg der Mittelpunkt seines Lebens. Eigene Buchgestaltungen übernahm Rohse ab 1953 und machte sich 1956 selbständig. Für die Graphik blieben ihm über Jahrzehnte hinweg Holzstich (eine besondere Form des Holzschnitts) und Kupferstich die bevorzugten Ausdrucksmittel.
Seit 1964 gab Otto Rohse in seiner Privatpresse klassische literarische Texte mit eigenen Graphiken und in höchster Vollendung der Buchform heraus. Mit diesen vielfach preisgekrönten Pressendrucken (2002 schließlich der Gutenberg-Preis) entwickelte er in der Nachkriegszeit, als die Massenproduktion von Büchern neue Ausmaße erreichte, den hohen Anspruch der Buchkunstbewegung der Jahrhundertwende weiter.
Einer breiten Öffentlichkeit wurde Rohse ab den 1960ern vor allem durch seine Briefmarken bekannt, die über Jahrzehnte das Bild der Bundesrepublik im In- und Ausland prägten. Seine Motive aus der Architekturgeschichte von West und Ost überwanden symbolisch die Deutsche Teilung (wenn auch von der DDR scharf kritisiert). Mit seinen Naturschutzmarken gab Rohse dem zunehmenden Umweltbewusstsein ein Gesicht.
Otto Rohse starb 2016 in Hamburg. Zu seinem 100. Geburtstag zeigt das Deutsche Buch- und Schriftmuseum eine dauerhafte virtuelle Ausstellung, die mit zahlreichen Exponaten aus Familienbesitz und der Sammlung des Museums einen reich bebilderten Einblick in das Leben und Werk des Künstlers bietet. – Eine kleine Auswahl der DBSM-Sammlung Otto Rohse ist zudem im Museumslesesaal der DNB Leipzig zu besichtigen.
(Auszüge aus dem Text von Benjamin Sasse im Blog zur virtuellen Ausstellung)
Die Hamburger Buchhandlung Wassermann feiert Otto Rohse und sein Werk mit einer dreiwöchigen Ausstellung, die am 27. September in Anwesenheit von Friederike Rohse und Till Verclas eröffnet wird (siehe Terminkalender). Im Fokus der Eröffnung wird das neue Buch Bon. Otto Rohse zum 100. Geburtstag, erschienen im Verlag UN ANNO UN LIBRO Omaggio, stehen. Während der gesamten Ausstellungszeit können ausgewählte und limitierte Bücher von Otto Rohse erworben werden.
Virtuelle Ausstellung Leipzig:
Rohse_100_virtuell
Ausstellung Buchhandlung Wassermann:
Rohse_100_Buchhandlung_Wassermann
Abbildung: Otto Rohse, Lagune II, aus Goethe, Venezianische Epigramme, Hamburg 1967. Druckstock zersägt, separat eingefärbt und zusammen gedruckt.
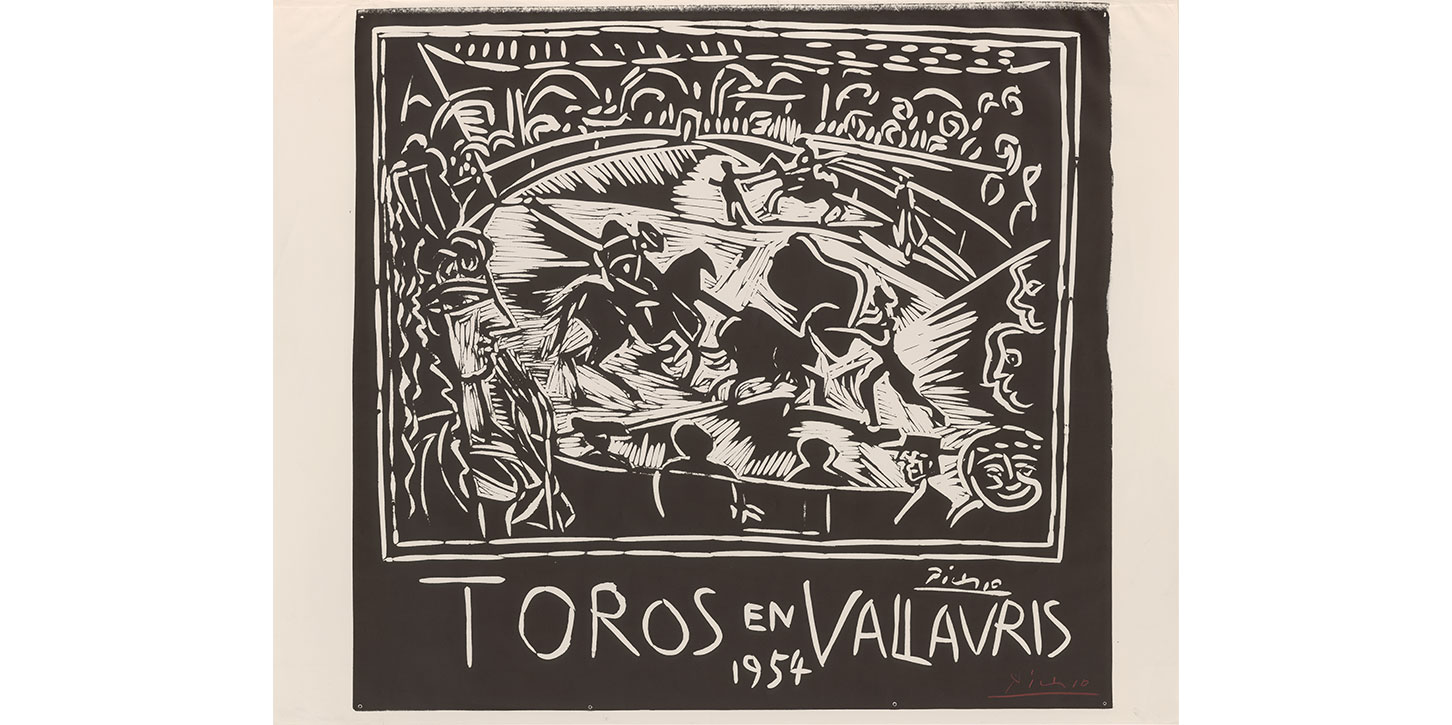
Zürich: Picasso | Bloch. Eine einzigartige Freundschaft
bis 9. November 2025
Licht im Papier. Druckgraphik von James Turrell
ETH Zürich. Graphische Sammlung
Rämistr. 101, HG E 52, 8092 Zürich
Sammler, Förderer, Freund: Der Schweizer Sammler Georges Bloch bewunderte Picassos Graphik, erwarb sie und gab als exzellenter Kenner das Werkverzeichnis seiner Druckgraphik in vier Bänden heraus. Der Künstler wiederum schätzte Blochs Fachwissen und seine Freundschaft. Die Geschichte dieser Begegnung auf Augenhöhe ist Thema der Ausstellung und des Katalogs der Graphischen Sammlung ETH Zürich. Dort wird ihre einzigartige Beziehung nachgezeichnet, die außerhalb von Fachkreisen wenig bekannt ist. Anhand von rund 80 Werken – von den Anfängen bis zur Spätphase – ist mitzuverfolgen, welch faszinierende Werke Picasso im Bereich der Druckgraphik schuf.
Zur Ausstellung erscheint ein zweisprachiger Ausstellungskatalog (dt./engl.) mit Beiträgen von Catherine Daunt, British Museum, Mariko Mugwyler und Linda Schädler, beide Graphische Sammlung ETH Zürich. Preis: 38 CHF.
Das Begleitprogramm finden Sie hier:
Zurich_Picasso_Bloch_Begleitprogramm
Hier der Flyer zum Download:
GRS-PICASSO-Flyer
Bild:
Pablo Picasso, Toros en Vallauris 1954, Linolschnitt 1954, 75,6 × 95,4 cm, Inv.-Nr. 1093.291, Graphische Sammlung ETH Zürich, Depositum Gottfried Keller-Stiftung, Schenkung Bloch, Zugang 1972; © Succession Picasso / 2025, ProLitteris, Zurich

Druckgraphiken von Lovis Corinth – Schenkung an die KSW
Zum 100. Todestag von Lovis Corinth (1858–1925) erhalten die Graphischen Sammlungen der Klassik Stiftung Weimar aus der Sammlung HHW eine Schenkung von 18 Druckgraphiken des Malers Lovis Corinth.
Dazu die Direktorin der Museen, Dr. Annette Ludwig: «2023 hat uns das Ehepaar Hildegard und Dr. Herbert (†) Wippel eine herausragende Kollektion an Holzschnitten des Bauhausmeisters Gerhard Marcks (1889–1981) als Schenkung übereignet. Nun können wir aus dieser Verbundenheit […] erneut eine weitere, äußerst willkommene Ergänzung der Bestände präsentieren. Für Corinth war die Weimarer Malerschule wegen ihrer frühen Rezeption der französischen Pleinairmalerei immer ein wichtiger künstlerischer Bezugspunkt. Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Großzügigkeit der Sammler.»
Die Mehrzahl der vorzüglichen Druckgraphiken der Schenkung Wippel stammen aus Corinths letzten Jahren und zeigen die unmittelbare landschaftliche Umgebung des Walchensees. Abgerundet wird das Konvolut durch den lithographischen Zyklus Schweizer Landschaften (1923) sowie die noch in Berlin entstandenen Einzeldrucke Skizzen zu einem orientalischen Märchen (1913) und Tiger (1917/18), die auch exemplarisch für Corinths Wirken als Illustrator stehen.
Abbildung: Lovis Corinth, Walchensee mit Jochberg, aus dem Mappenwerk Der Walchensee (klein), 1923, Kaltnadelradierung. Klassik Stiftung Weimar, Museen, Schenkung HHW
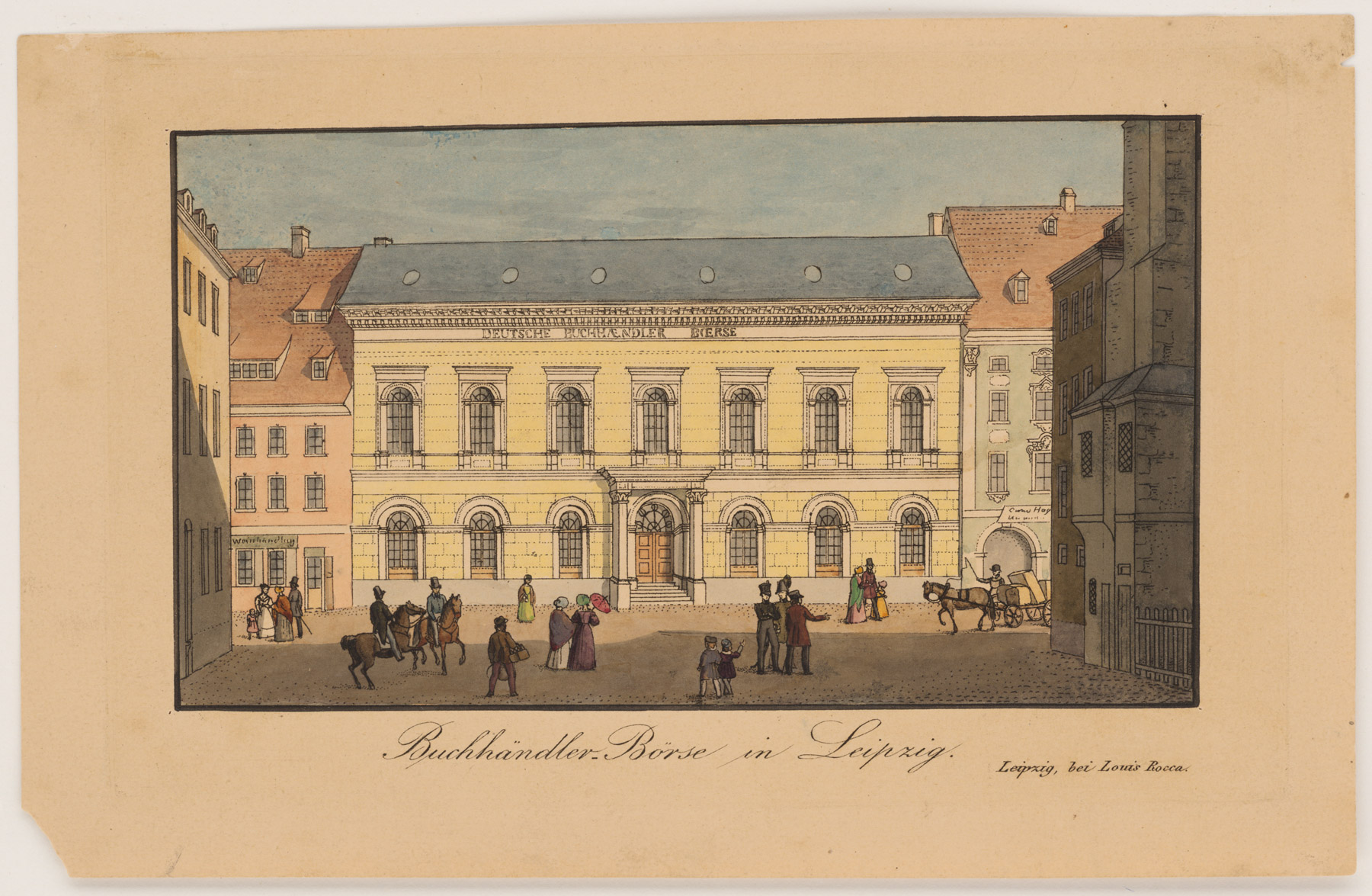
DBSM Leipzig: 200 Jahre Börsenverein des Deutschen Buchhandels
bis 15. Dezember 2025
Zwischen Zeilen und Zeiten.
200 Jahre Börsenverein des Deutschen Buchhandels
Kabinettausstellung im Deutschen Buch- und Schriftmuseum der DNB
Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig
Gegründet am 30. April 1825 in Leipzig, ist der Börsenverein heute der älteste noch bestehende Buchhandelsverband Europas – ein Stück gelebte Demokratiegeschichte. Nach Kriegswirren, Teilung und Wiedervereinigung vereint er heute rund 4000 Mitglieder aus der gesamten Buchbranche – von Verlagen und Buchhandlungen bis zu Antiquariaten und Verlagsvertretungen.
Die Ausstellung zeigt ausgewählte Originale aus zwei Jahrhunderten bewegter Buch- und Verlagsgeschichte. In acht Kapiteln erzählt sie von mutigen Verlegern, klugen Ideen, politischen Umbrüchen und praktischen Lösungen – von der ersten Buchmesse-Abrechnung über Raubdruck-Streitigkeiten bis zur Mitgründung der Deutschen Bücherei im Jahr 1912, der heutigen Deutschen Nationalbibliothek.
Unter dem Titel Zwischen Zeilen und Zeiten. Buchhandel und Verlage 1825–2025 ist zum Jubiläum eine Publikation erschienen: Herausgegeben von Christine Haug und Stephanie Jacobs, Göttingen: Wallstein Verlag 2025; 568 S., zahlr. Abb., Klappenbroschur, Farbschnitt, 17×21,5 cm, ISBN 978-3-8353-5847-8. 28 Euro, erhältlich im Buchhandel oder im Deutschen Buch- und Schriftmuseum.
Bild: Buchhändler-Börse in Leipzig. Kolorierte Radierung, bez. u.r.: Leipzig, bei Louis Rocca, ca. 1840.

CMF: Michael Sowa. Fragile Idyllen
28. Juni bis 9. November 2025
Michael Sowa. Fragile Idyllen
Caricatura Museum für Komische Kunst Frankfurt
Weckmarkt 17, 60311 Frankfurt am Main
Das Caricatura Museum Frankfurt würdigt den renommierten Maler und Illustrator Michael Sowa anlässlich seines 80. Geburtstags mit einer umfassenden Einzelausstellung. Diese bietet einen ebenso repräsentativen wie exklusiven Einblick in das große Werk eines Künstlers, der sich damit in das kollektive Bildgedächtnis der Bundesrepublik Deutschland eingeschrieben hat.
Charakteristisch für seine Arbeiten ist eine altmeisterlich anmutende Malweise in Acryl häufig in gedeckten Farben und erdigen Tönen. Diese verleihen seinen melancholisch-traumhaften Bildern eine besondere Tiefe, die oft mit einer tragikomischen Note verbunden ist. Die Sowa’sche Komik lebt von den Kontrasten: mal durch das Spannungsverhältnis zwischen feinmalerischer Technik und naivem Inhalt, mal durch den Bruch des Alltäglichen durch obskure Requisiten.
Dank knapp 50 privater Leihgeber und Leihgeberinnen ist nun eine Zusammenstellung gelungen, die es so noch nie zu sehen gab. Finanzielle Unterstützung kam vom Kulturfonds Frankfurt RheinMain und von der FAZIT-Stiftung.
Bild: Köhlers Jungschwein © Michael Sowa
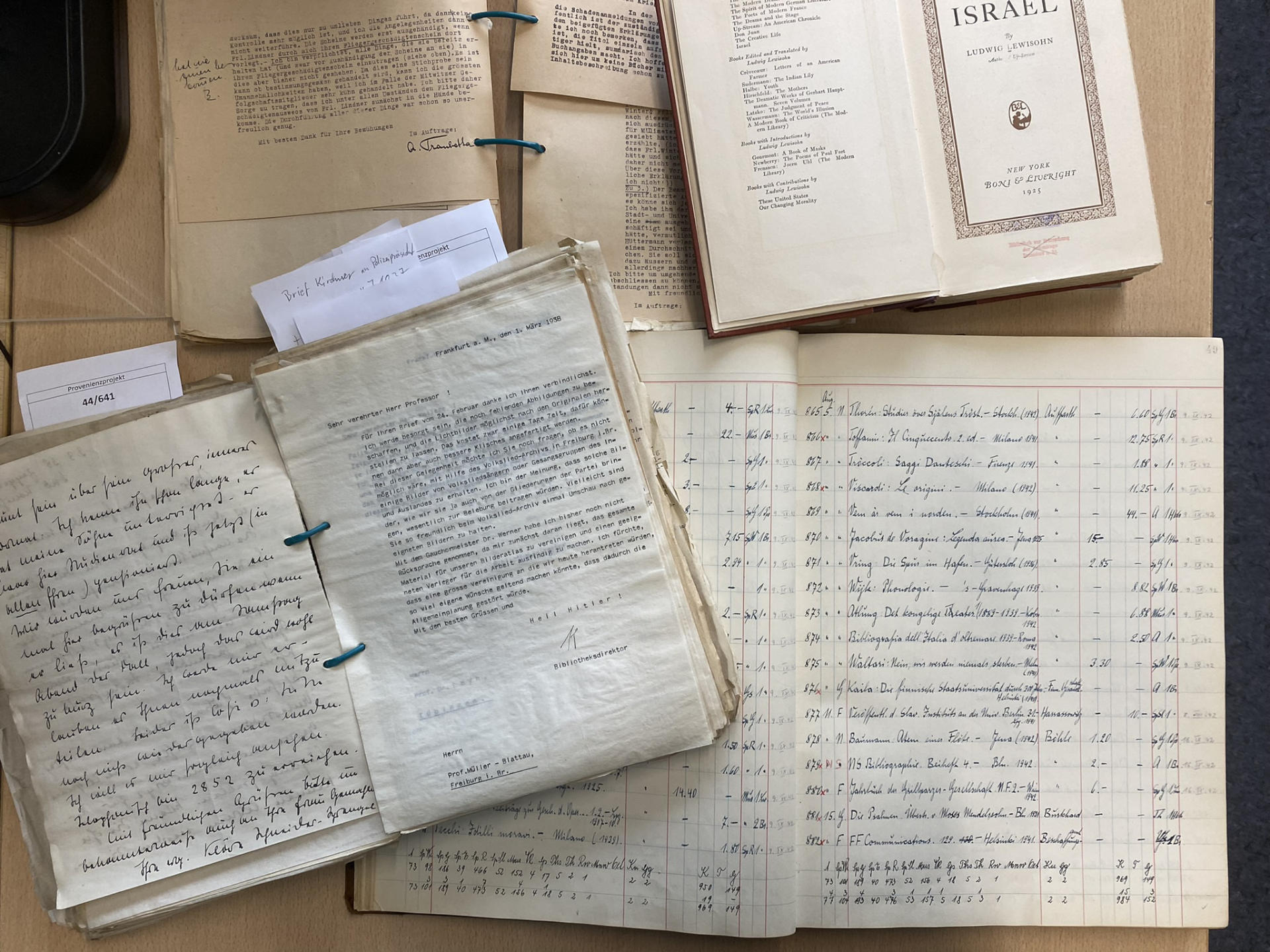
Provenienzforschung an der UB Frankfurt: mehr NS-Raubgut als erwartet
Erstes Projekt zur Provenienzforschung an der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg der Goethe-Universität fördert mehr NS-Raubgut zutage als erwartet und zeigt weiteren Bedarf.
Das Projektteam konnte anhand von Stempeln, Exlibris und Vermerken in den mehr als 75.000 Büchern, die im ersten Projektabschnitt beforscht wurden, deren Herkunft nachzeichnen. Dabei wurden rund 7.500 Bücher entdeckt, die sich 350 unterschiedlichen Vorbesitzern zuordnen lassen und bei welchen ein unrechtmäßiger Entzug wahrscheinlich ist.
Etliche Bücher wurden inzwischen restituiert, also an die rechtmäßigen Besitzer beziehungsweise deren Erben zurückgegeben. In 35 Fällen mit insgesamt 90 Bänden konnte eine faire und gerechte Lösung im Sinne der Washingtoner Erklärung gefunden werden – darunter Rückgaben, Rückschenkungen sowie Rückkäufe. Bücher aus der Frankfurter Universitätsbibliothek wurden an Privatpersonen im In- und Ausland restituiert sowie an eine Vielzahl von Organisationen, darunter politische Parteien, Gewerkschaften, jüdische Gemeinden oder Freimaurerlogen.
Ein besonders bedeutender Fall sind die Bücher aus dem Antiquariat Baer, einer Frankfurter Institution von Weltrang, die 1934 durch den NS-Staat liquidiert wurde. Das Projektteam der Bibliothek hat allein im ersten Projekt mehr als 5000 Bände aus dem Antiquariat Baer identifiziert, die als NS-Raubgut anzusehen sind. Ziel ist es nun, mit den Erben des Antiquariats in Kontakt zu treten, um gemeinsam eine faire und gerechte Lösung zu entwickeln.
Mehr Informationen hier:
Provenienzforschung_UB-Frankfurt
Abb.: Für die Erforschung der Herkunft von Büchern sind verschiedene Quellen wichtig – vor allem das Buch selbst, aber auch alte Inventarlisten und Akten. Foto: Daniel Dudde.
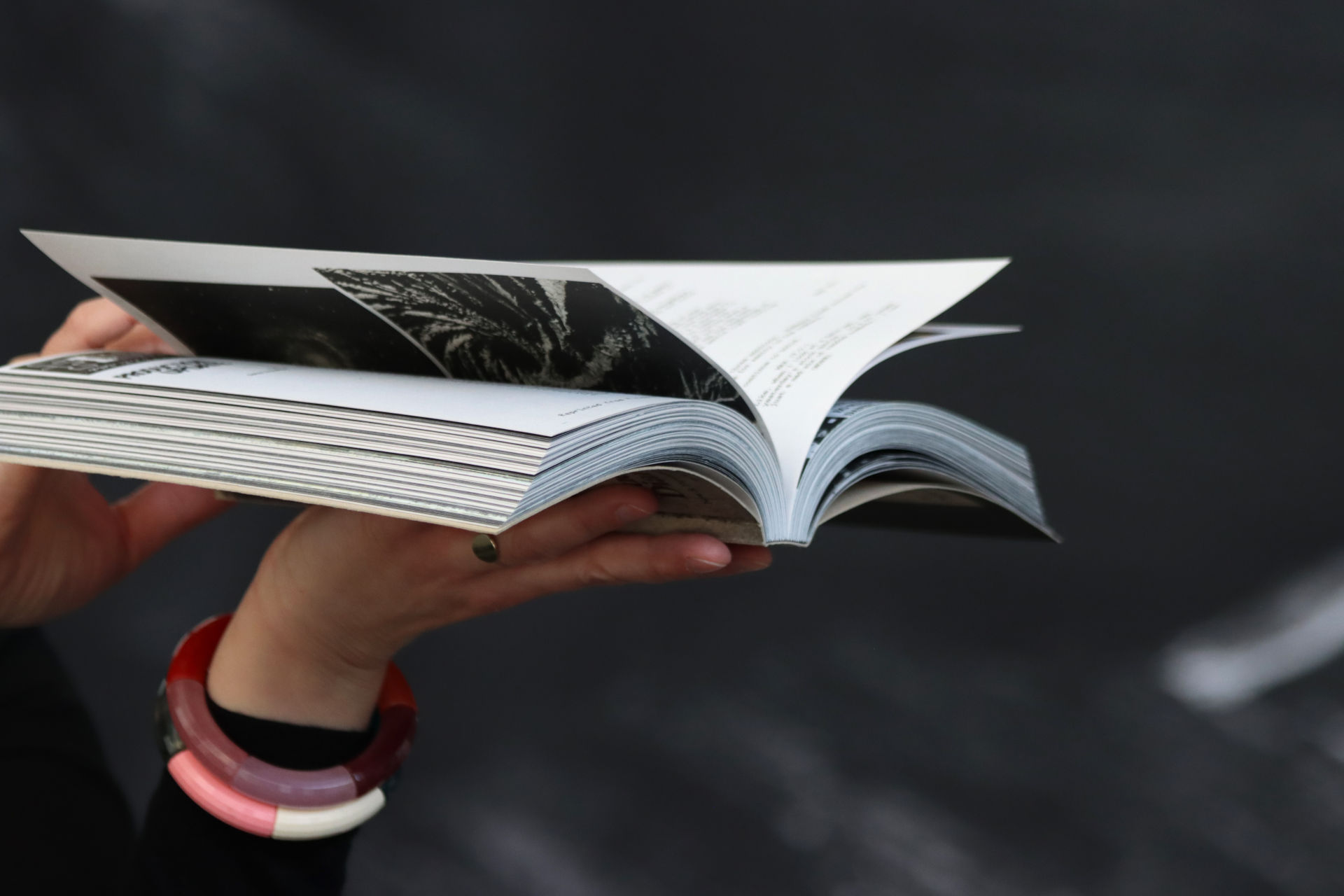
Lesekrise?
«Lange Sätze galten einst als sprachliche Krönung. Heute verstehen 20 Prozent der Deutschen keine komplexen Texte und angehende Lehrkräfte kennen teilweise Brecht nicht mehr. Das Smartphone und Social Media verschärfen die Krise zusätzlich dramatisch. Was bedeutet das für uns? Zeit, dass Gesellschaft, Wissenschaft, Medien und die Typografie [nicht zu vergessen die Bibliophilie, Anm. Werfel] Verantwortung übernehmen!»
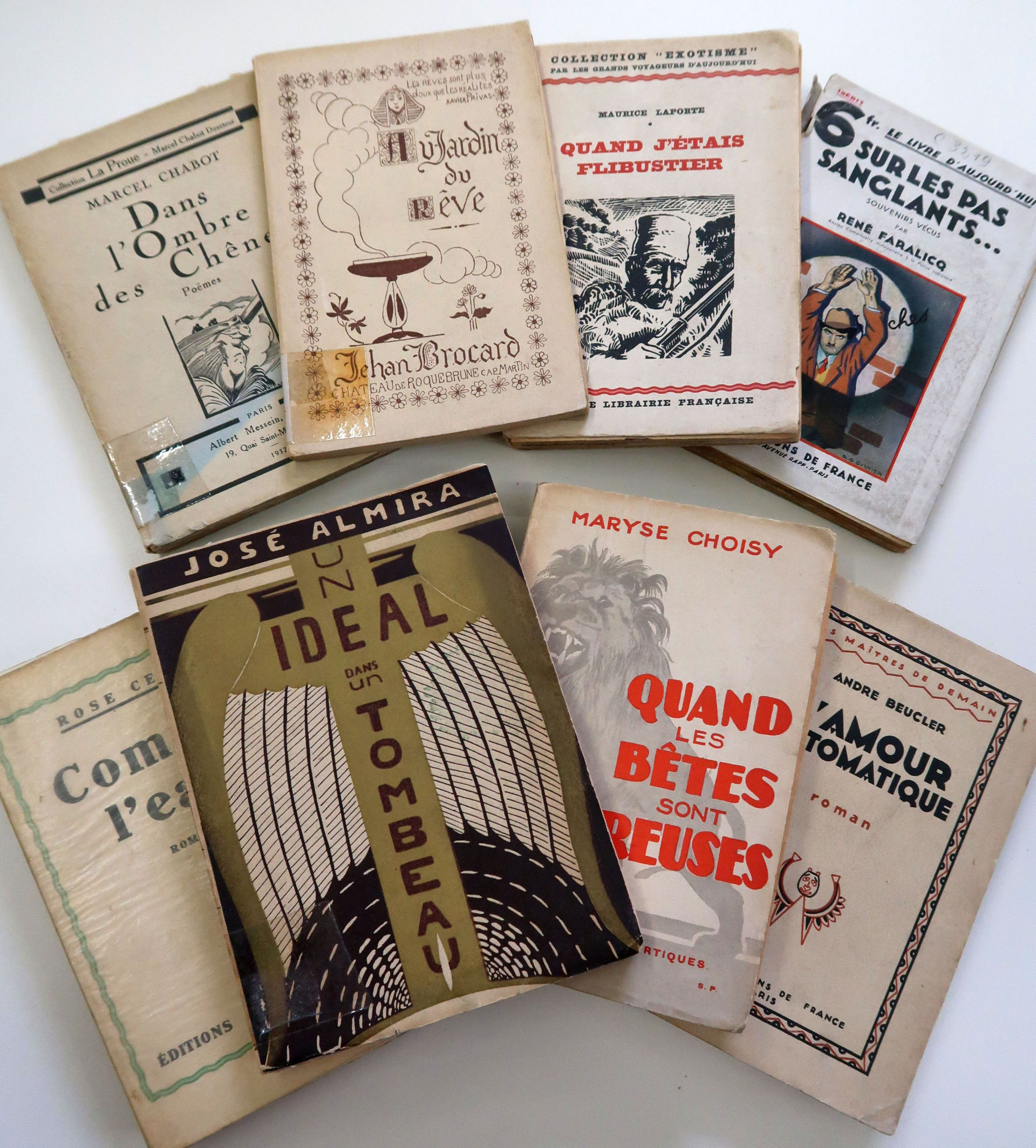
221 Bücher an die Nachfahren von Henry Torrés restituiert
Fünf deutsche Kultureinrichtungen haben am 26. Juni 2025 in Paris den Nachfahren des bekannten französischen Anwalts, Journalisten und Politikers Henry Torrés (1891–1966) 221 Bücher übergeben. Es handelt sich um Werke, die Torrés und seine Partnerinnen vornehmlich in den 1920er und 1930er Jahren von den Autorinnen und Autoren politischer und historischer Publikationen sowie belletristischer Werke und Theaterstücke geschenkt bekamen. Viele sind mit handschriftlichen Widmungen versehen, in denen Torrés als persönlicher Freund angesprochen wird.
An der Restitution waren mehrere Institutionen beteiligt: 95 Bände stammen aus der Staatsbibliothek zu Berlin, 93 Bände aus dem Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin (ZfL). Hinzu kommen weitere 33 Bücher aus der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB Dresden), der Universitätsbibliothek Rostock und der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz.
Bücher aus der Bibliothek Torrés, Foto: Staatsbibliothek zu Berlin
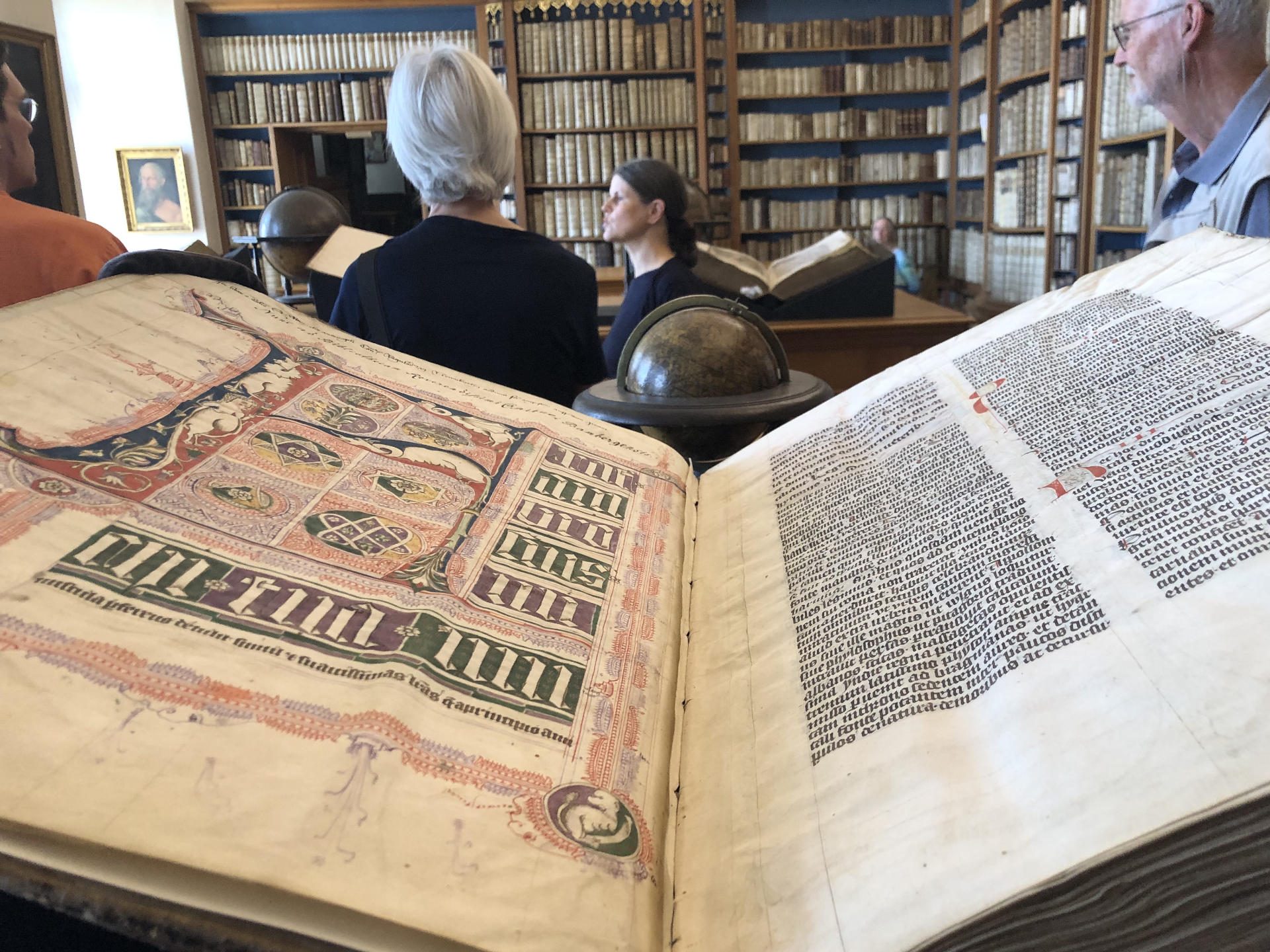
Gelungenes Jahrestreffen 2025 in Bamberg

Verbotenes im CMF
bis 21. September 2025
Caricatura Salon #3: Rudi Hu. Europa
Caricatura Museum für Komische Kunst Frankfurt
Weckmarkt 17, 60311 Frankfurt am Main
Der Caricatura Salon #3 präsentiert die von der Europäischen Union verbotene Ausstellung RUDI HU. EUROPA.
Die 19 Gemälde des deutschen Malers und Schriftstellers Rudi Hurzlmeier (geb. 1952) entstanden im Auftrag des EU-Abgeordneten Martin Sonneborn (fraktionslos), der den Künstler um seine Sicht auf die Europäische Union bat. Die Ausstellung war zur Präsentation in den Räumen der EU in Brüssel konzipiert. Dazu sollte es jedoch nicht kommen. Kurzerhand machte die Verwaltung des Parlaments von ihrem Hausrecht Gebrauch und verbot die Ausstellung. Lapidare Begründung: Die Bilder seien anstößig und stünden im Widerspruch zu europäischen Werten. – Einladung, sich selbst ein Bild zu machen.
Live-Malerei: Rudi Hurzlmeier malt vom 18. bis 20. Juli 2025 live vor den Besucherinnen und Besuchern im Caricatura Museum an seinem Gemälde Nocturne – Satan öffnet den Erlöser weiter.
Bild: Aliens in der EU-Ehrenloge, © Rudi Hurzlmeier

Wiesbaden: Gezeichnete Erinnerung im Comic
bis 13. Juli 2025
Ich werde nicht schweigen! Gezeichnete Erinnerung im Comic
Kunsthaus Wiesbaden
Schulberg 10, 65183 Wiesbaden
Die Ausstellung stellt vier internationale, vielfach ausgezeichnete Künstler:innen – Hannah Brinkmann, Tobi Dahmen, Nora Krug und Birgit Weyhe – vor, die mit den Mitteln der grafischen Erzählung Geschichte ausleuchten. Sie setzt damit den Themenschwerpunkt Demokratieförderung durch Erinnerungskultur fort.
Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen schicksalsvolle Lebenswege, die daran erinnern, dass die Vergangenheit Teil unserer Gegenwart ist, und die verdeutlichen, wie wichtig Demokratie ist. Die Schau präsentiert Originalzeichnungen, Skizzen, Recherchematerial und Interviews mit Beteiligten. Sie veranschaulicht zudem die ästhetisch sehr unterschiedlichen Herangehensweisen und macht den Entstehungsprozess der Comics sowie die Möglichkeiten grafischer Erzählungen sichtbar.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Jakob Hoffmann. Sie wird anlässlich des 80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges gezeigt. Die Schirmherrschaft hat Prof. Dr. Aleida Assmann übernommen.
Hier der Ausstellungsfaltblatt mit Begleitprogramm zum Download:
Ich_werde_nicht_schweigen_Gezeichnete_Erinnerung_im_Comic_KH
Bild: Blick in die Ausstellung. Foto © Patrick Bäuml, Wiesbaden
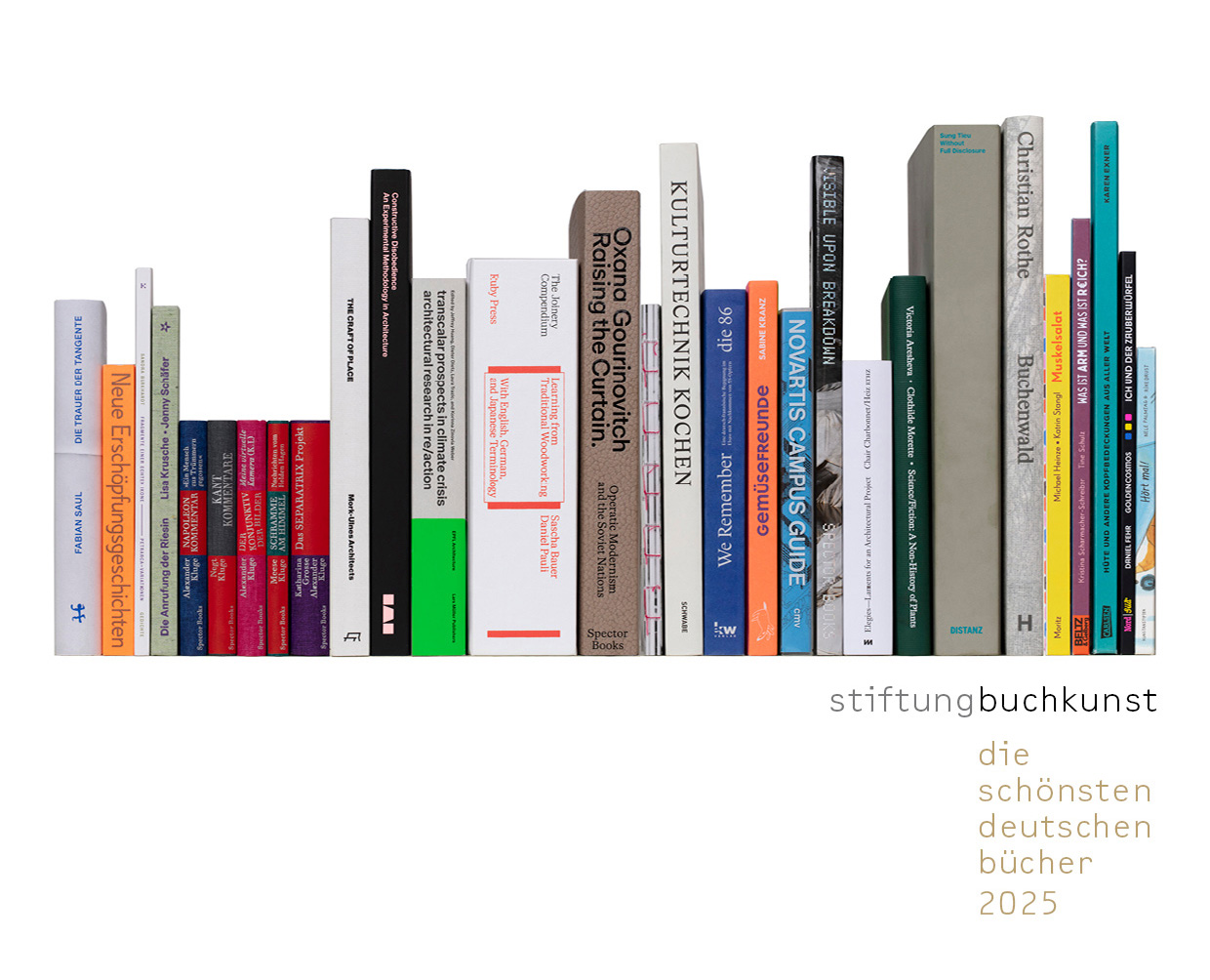
«Die schönsten deutschen Bücher 2025»
«Vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung»:
Rund 600 Bücher wurden zum Wettbewerb der Stiftung Buchkunst eingereicht. In einem aufwendigen zweistufigen Jurierungsverfahren kürten zwei Expertenjuries in fünf Kategorien die 25 Schönsten deutschen Bücher des Jahres 2025.
Zwei Stimmen aus der Jury 2025 über die Wirkmacht «schönster» Bücher:
Für die Berliner Gestalterin Chrish Knigge (Studio Grau) ist ein schönes Buch «mehr als das Material, die Schrift, die Farbe und der Inhalt – es ist ein Raum, der sich öffnet und Resonanz erzeugt». Viktoria Napp (kunstanstifter) zeigt sich besonders berührt von Büchern, «die sich mit Themen beschäftigen, die sonst eher im Hintergrund bleiben und wie diese Themen umgesetzt wurden. Solche Bücher machen deutlich, wie Gestaltung dabei helfen kann, Tabus aufzulösen – und schwierige Themen offen und schön zugänglich zu machen.»
Die prämierten Titel sind zugleich für den mit 10 000 Euro dotierten Preis der Stiftung Buchkunst nominiert. Das Geheimnis um das von einer Sonderjury auserwählte «allerschönste» deutsche Buch wird bei der Preisverleihung am 5. September 2025 im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main gelüftet.
Faltblatt mit den gekürten Büchern zum Download:
DSDB25_praemierte_25
Bildnachweis:
© Stiftung Buchkunst, Foto: Uwe Dettmar

Klingspor Museum: Grenzenlosigkeit im zeitgenössischen Comic
bis 27. Juli 2025
Von der Seite in den Raum.
Grenzenlosigkeit im zeitgenössischen Comic
Klingspor Museum, Herrnstraße 80, 63065 Offenbach
Präsentiert wird eine vielseitige Auswahl an Werken, die eindrucksvoll veranschaulichen, wie Comics über das klassische Buchformat hinauswachsen können. Dreizehn zeitgenössische Comic-Künstler:innen bringen ihre gezeichneten Geschichten in den Ausstellungsraum und lassen diese dort auf vielfältige Weise erlebbar werden – durch großflächige Illustrationen, Figuren aus Keramik und Textil, begehbare Objekte und Klanginstallationen. Neben den dreidimensionalen Arbeiten werden auch originale Zeichnungen, Skizzen sowie eine Auswahl an aktuellen Comics gezeigt.
Ausstellungsplakat: © Aisha Franz

Mainz: V.O.Stomps-Förderpreis geht nach São Paulo
Der seit 2009 neben dem Hauptpreis zusätzlich verliehene und mit 1500 Euro dotierte V.O.Stomps-Förderpreis der Stadt Mainz ging dieses Jahr an den Verlag Lote 42 von Cecilia Arbolave und João Varella in São Paulo. Zusammen arbeiten sie seit 2012 an mehr als nur dem Publizieren von Büchern: Sie organisieren Buchmessen für die Independent-Szene, geben Druck-Workshops und bringen hochwertige, kunstvolle und verspielte Bücher heraus, immer unter der Prämisse, dass diese auch mit kleinem Einkommen erschwinglich sein müssen. Inhaltliche Vielseitigkeit prägt das Verlagsprogramm.
Cecilia Arbolave bedankte sich in einer zu Herzen gehenden Rede für den Preis, die Laudatio hielt mit viel Einfühlungsvermögen Patricia Sant’Ana Scheld, die in Wiesbaden-Biebrich ihr «Illustralabor» betreibt.
Bild:
Cecilia Arbolave an ihrem Stand auf der MMPM 2025. Foto: Silvia Werfel

Mainz: V.O.Stomps-Hauptpreis verliehen
Alle zwei Jahre: Auf der Mainzer Minipressenmesse 2025 wurden in einem abendlichen Festakt die V.O.Stomps-Preise der Landeshauptstadt Mainz vergeben.
Der mit 3500 Euro dotierte Hauptpreis ging an den 2016 in Berlin gegründeten Verlag Das kulturelle Gedächtnis.
Den Gesellschafter:innen und Kurator:innen – derzeit Beate Swoboda, Peter Graf und Tobias Roth – geht es um Wiederentdeckungen von Verschollenem ebenso wie um das Bewahren von Tradiertem, wie die Neu- und Erstübersetzungen von Voltaire oder Victor Hugo beweisen. Eindeutig dabei ist die immer gesellschaftliche Aktualität der Werke für das Hier und Jetzt sowie die Ausgewogenheit in der Herstellung: Moderne Distribution trifft feinsten Sinn für Satz, Papier und Einband.
Tobias Roth nahm den Preis entgegen. Die begeistert-begeisternde Laudatio hielt Prof. Dr. Gerhard Lauer, Leiter der Mainzer Buchwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität.
In einer der beiden nächsten Ausgaben der Wandelhalle für Bücherfreunde wird – endlich – das schon länger geplante Verlagsporträt erscheinen.

Leipzig: Steine, Tusche, Papier und Pixel
bis 31. August 2025
Steine, Tusche, Papier und Pixel
Chinesische Steinabreibungen in digitalen Werken
Museum für Druckkunst, Nonnenstraße 38, 04229 Leipzig
Die chinesische Steinabreibung ist eines der ältesten Verfahren, um Texte und Bilder zu vervielfältigen. Die Ausstellung im Museum für Druckkunst Leipzig widmet sich dieser frühen Technik, die vor über zweitausend Jahren im alten China ihren Ursprung hat. Zu bestaunen sind Abreibungen von historischen Inschriften und Bildgravuren, die von der Zhou-Dynastie bis ins 20. Jahrhundert das chinesische Kulturleben eindrucksvoll widerspiegeln. Ein Highlight der Schau ist der künstlerische Einsatz von Augmented Reality durch die deutsch-chinesische Künstlerin Yi Meng Wu, die die schwarz getuschten Darstellungen farbenprächtig animiert hat.
Die Exponate entstammen einer Privatsammlung aus dem Fundus der Gesellschaft für Deutsch- Chinesische Freundschaft in Berlin e.V., die das Konfuzius-Institut Leipzig 2023 übernommen hat.
Bild:
Die Vogeljagd, 70×70 cm, Zentralszene des Opferschreins Grabanlage Wu Liang zi in Qia Xiang Xian, Provinz Shandong, 147 u.Z. Foto © Museum für Druckkunst, Leipzig

Berlin: 200 Jahre «Kleine Ausgabe» der «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm
bis 13. Juli 2025
Im Fokus: «200 Jahre «Kleine Ausgabe» der «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm»
Stabi Kulturwerk, Staatsbibliothek zu Berlin
Unter den Linden 8, 10117 Berlin
Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm wurden richtig erfolgreich erst durch die Kleine Ausgabe, die vor 200 Jahren erstmals im Verlag von Reimer in Berlin erschien. Hier wurden fünfzig Märchen aus der Sammlung speziell für Kinder ausgewählt. Ludwig Emil Grimm, der jüngere Bruder der Brüder Grimm, steuerte sieben Illustrationen bei.
Die Fokusausstellung zeigt einen kleinen Querschnitt durch die Geschichte der Grimm-Illustrationen – von Ludwig Emil Grimm bis heute. Zu sehen sind europäische Kinder- und Märchenbilderbücher aus drei Jahrhunderten, in denen die Welt von Grimms Märchen durch bezaubernde Illustrationen als Buchschmuck immer wieder neu gesehen wurde.
Bild:
Jacob und Wilhelm Grimm, Marienkind, gezeichnet von Heinrich Lefler und Joseph Urban, Mainz (Scholz), 1904. Heinrich Lefler (1863–1919) und sein Schwager Joseph Urban (1872–1933) gestalteten mit dem Legendenmärchen Marienkind der Brüder Grimm eines der berühmtesten Künstlerbilderbücher im Wiener Jugendstil.

Wien: Die Pfeile des wilden Apollo
bis 25. Mai 2025
Die Pfeile des wilden Apollo. Klopstockkult & Ossianfieber
Akademie der bildenden Künste Wien, Gemäldegalerie und Exhibit Galerie
Schillerplatz 3, 1010 Wien
Jahrzehnte vor der Französischen Revolution kam es in der Ära der Aufklärung zu einem abrupten Einbruch des Irrationalen, der sich in überschwänglichen Gefühlsäußerungen, in Vorstellungen eines spiritualistischen Geschlechtertauschs und einer gebrochenen, heroisch-introspektiven Kunstauffassung äußerte. Der sich abzeichnende Epochenwechsel leitete eine für die Bildkunst problematische Ablösung des Augenscheins durch das Sphärische und Diffuse ein mit einer verstärkten Hinwendung zur Akustik. Nichts scheint diesen «acoustic turn» besser zu fassen als der Topos des blinden Sehers und Dichtersängers, der in den Ausprägungen eines Homer, eines Ossian und eines John Milton als dichterisches Leitbild dieses Epochenwechsels fungierte.
Die von dem Zeichner und Bildhistoriker Alexander Roob kuratierte Ausstellung reflektiert anhand einiger signifikanter künstlerischer Beispiele den Epochenwechsel von der Aufklärung zum Irrationalismus des Sturm und Drang und der Romantik. Erstmals wird Klopstocks immenser Einfluss auf die Bildkunst und Musik seiner Zeit beleuchtet.
Neben Werken aus der Gemäldegalerie und zahlreichen Leihgaben bilden Exponate aus dem Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien einen Schwerpunkt in der Ausstellung. Das Projekt wird weiters im Rahmen der Lehre unter Beteiligung von Studierenden der Akademie der bildenden Künste Wien ausgeführt und ist in der Exhibit Galerie und drei Räumen der Gemäldegalerie zu sehen.
Als Begleitbuch ist ein umfangreicher Bild-Essay-Band erschienen (Textem Verlag, 248 S., ca. 170 Farbabb., Softcover, 32 €) sowie ein 64-seitiges Booklet, hier zum Download: die_pfeile_booklet_de_digital
Bild: Motiv unter Verwendung von Werken von Johann P. Pichler nach Heinrich F. Füger, Homer vortragend, 1803 © Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien, und Carl Wilhelm Kolbe d. Ä., Schlittschuhlaufender Barde („Braga“), 1793–1794, © Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett / bpk, Foto: Julia Bau, Gestaltung Kompositmotiv: Beton

CMF: Die komische Kunst des Walter Moers
bis 15. Juni 2025
Die Komische Kunst des Walter Moers.
Vom Käpt’n Blaubär, dem Kleinen Arschloch und dem fantastischen Kontinent Zamonien
Caricatura Museum für Komische Kunst Frankfurt
Weckmarkt 17, 60311 Frankfurt am Main
Walter Moers schuf mit Käpt’n Blaubär, «dem größten Lügenbären aller Zeiten», mit dem Kleinen Arschloch und mit Hildegunst von Mythenmetz Ikonen der Komischen Kunst. Seine im Kontinent Zamonien spielenden Romane sind ein Kaleidoskop der komischen Stilmittel, phantasie- und liebevoll gestaltet – vom Einband bis hin zum Lesebändchen. Text, Bild und Schrift sind kongenial verschränkt, führen fort oder ergänzen sich: in einer einmaligen Art und Weise.
Walter Moers selbst gilt als Phantom unter den Künstlern. Wenig ist aus seiner Biografie bekannt, öffentliche Auftritte scheut er. Verbürgt ist sein Geburtsjahr 1957 und sein Geburtsort Mönchengladbach. So lernt man ihn am besten in seiner Büchern kennen.
Die Ausstellung des Caricatura Museum Frankfurt zeigt eine breite Auswahl an Originalillustrationen und -comics wie auch unveröffentlichte Skizzen. Darunter seine Arbeiten für das endgültige Satiremagazin TITANIC, seine ikonischen Geschichten von Adolf, der Nazi-Sau und seinem Bonker und die Serie Arschloch in Öl, mit der sich Moers als wahrer Meister der Parodie präsentiert: Von der Frühzeit bis zur Moderne karikiert er bissig und originell die traditionelle Kunstgeschichte und den dazugehörigen Museumsbetrieb. Kurze Animationsfilme sowie Figuren aus der Hand des Bildhauers Carsten Sommer runden die Werkschau ab.
Bild: Blaubär im Schiff der Zwergpiraten aus Die 13 1⁄2 Leben des Käpt’n Blaubär (1999) © Penguin Verlag
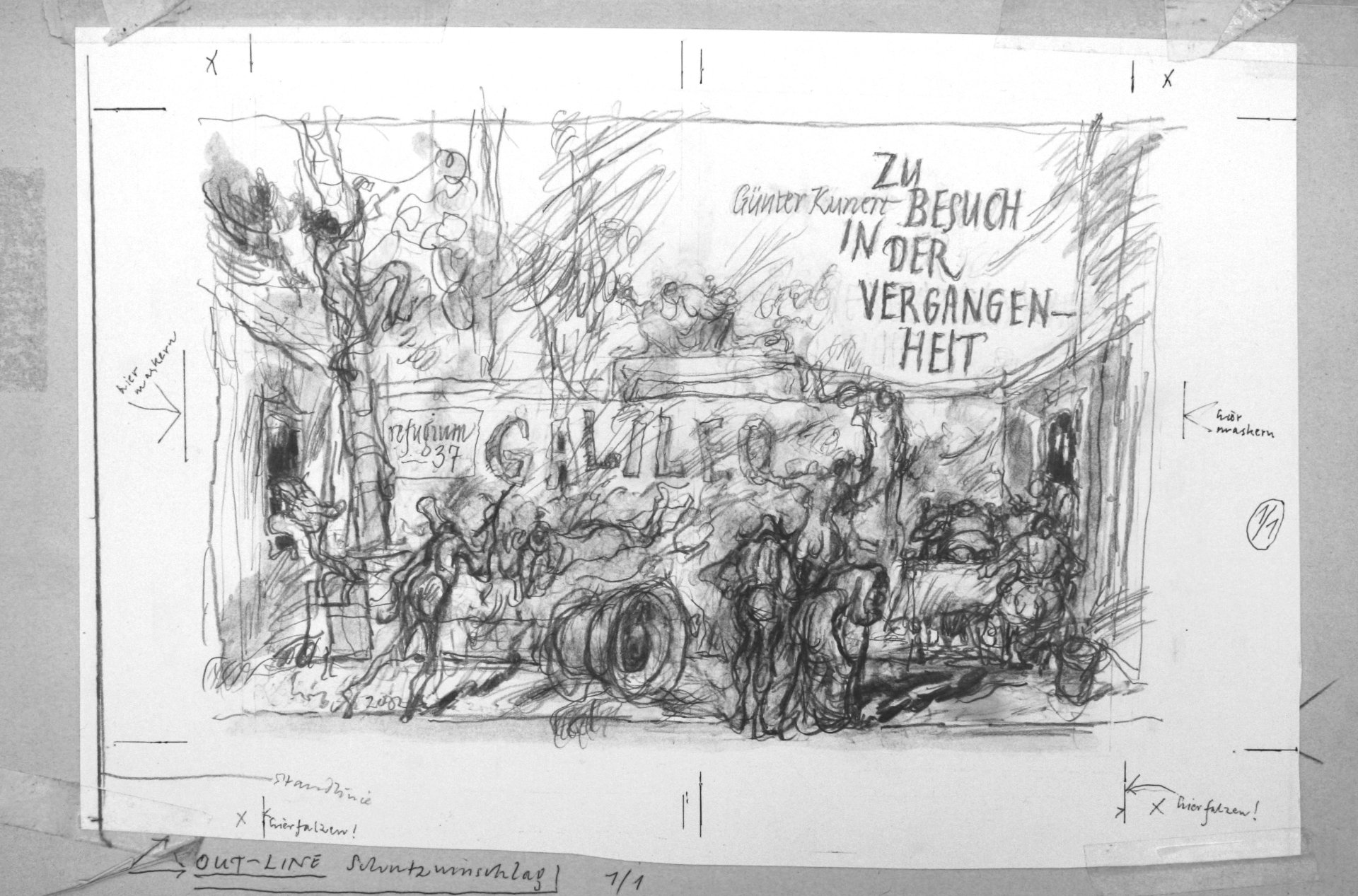
Gera: BücherKunst. Der Buchillustrator und Buchgestalter Kurt Löb
bis 17. September 2025
BücherKunst. Der Buchillustrator und Buchgestalter Kurt Löb (1926–2015)
Geraer Museum für Angewandte Kunst
Greizer Straße 37, 07545 Gera
«Nur wenige, die ein Buch mit Illustrationen in die Hand nehmen, erahnen den langwierigen Prozess seines Zustandekommens oder merken gar etwas von der argen Plagerei des armen Illustrators.» Mit diesen Worten Kurt Löbs, einem Meister der Buchkunst, begibt sich der Besucher auf Entdeckungstour durch das umfangreiche Werk dieses Illustrators, Typografen, Buchgestalters, Professors und Autors hinter die Kulissen der Buchkunst: Die erste Skizze, der typografische Entwurf, die ausgereifte Illustrationszeichnung oder die Druckform markieren den langen Weg zum fertigen Produkt Buch.
Neben illustrierten Büchern aus sechs Jahrzehnten, zeichnerischen Entwürfen und Grafiken aus Privatsammlungen bilden zwei Konvolute der selten zu sehenden Original-Illustrationszeichnungen von Kurt Löb den Höhepunkt der Ausstellung: Die Blätter zu Anton Tschechows Erzählungen Rothschilds Geige und zu Charles de Costers Die Geschichten von Ulenspiegel und Lamme Goedzak, die zu seinen Hauptwerken zählen.
Entwurf für das Cover zu Günter Kunerts Zu Besuch in der Vergangenheit. Foto: Anna Lehmann-Ertel
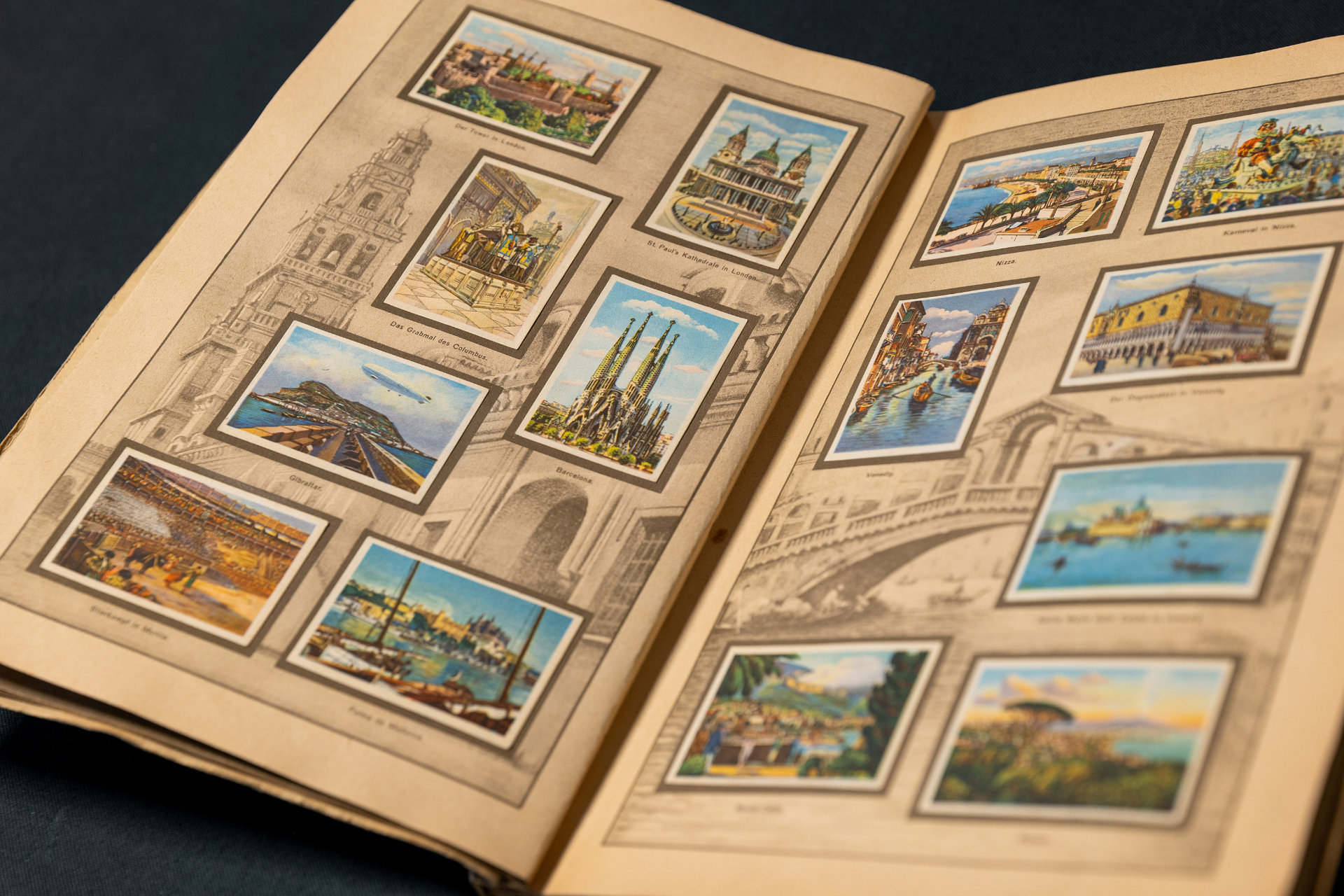
Karlsruhe: Die bunte Welt der Sammelalben
bis 27. September 2025
Wissen in Bildern – die bunte Welt der Sammelalben
Badische Landesbibliothek
Erbprinzenstraße 15, 76133 Karlsruhe
Mo bis Fr 9 bis 19 und Sa 10 bis 18 Uhr
Seit die Firma Liebig 1872 mit der Produktion von Sammelalben begann, hat das Sammeln nicht mehr aufgehört. Bildinhalte, Herstellungstechniken und Vertriebswege haben sich gewandelt. Immer gleich blieb das Erfolgskonzept der Markenbindung. Man ordnet und sortiert, tauscht und komplettiert.
Man hat die Bilder immer wieder zur Hand und eignet sich dabei ihr weltanschauliches Kapital an.
Die Reklamesammelbilder sind nicht nur als Dokumente der Gebrauchsgraphik, als Zeugnisse der Werbeindustrie, der Markenetablierung und der Konsumgeschichte, sondern auch als millionenfach verbreitete Belege der populären Bildkultur eine fantastische kulturgeschichtliche Quelle.
Einladung zum Mitmachen:
Welche Bilder haben Sie gesammelt? Machen Sie mit! Präsentieren Sie Ihr Lieblingsalbum als Album der Woche in unserer Sondervitrine und erzählen Sie seine Geschichte! Kontakt: sammelalben@blb-karlsruhe.de
Online-Katalog der Ausstellung:
blb_karlsruhe_Sammelalben
Bild: Eine Reise um die Welt. Sammelabum der Firma P. J. Landfried, Heidelberg, Rauchtabak-, Kautabak- und Zigarrenfabrik. Leipzig : J. J. Weber, 1933. Badische Landesbibliothek, 121 F 148 R

Mainz: «Le jardin du temps» – Künstlerbücher von Nikola Jaensch
bis 15. August 2025
Le jardin du temps
Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz
Rheinallee 3 B, 55118 Mainz, Treppenhaus, 2. Obergeschoss
Mo + Mi 10 bis 18 Uhr, Di 10 bis 17 Uhr, Do + Fr 10 bis 13 Uhr
Eintritt frei
Nikola Jaensch, geboren in Würzburg, lebt und arbeitet in Mainz sowie am Bodensee. Sie ist bekannt für ihre freie Handzeichnung, komplexe Collagen und künstlerisch gestaltete Bücher. Ihre Werke sind in renommierten Sammlungen vertreten, darunter das Gutenberg-Museum Mainz und das Arp Museum Rolandseck, und wurden international ausgestellt, etwa im Picasso-Museum Münster und im Museum für Moderne Kunst Wien. Zu ihren Auszeichnungen zählt unter anderem auch der Mainzer Stadtdruckerpreis, den sie 2004 erhielt.
Die Ausstellung zeigt einen Querschnitt aus ihrem Schaffen – von frühen Werkgruppen bis zu neuesten Arbeiten – mit Künstlerbüchern, graphischen und malerischen Unikaten.
Bild: Nikola Jaensch in ihrem Atelier im Atelier. © privat

HALLE14 in Leipzig zeigt die «Schönsten Bücher aus aller Welt» 2025
Noch bis zum 15. Juni 2025 zeigt die HALLE 14 – Zentrum für zeitgenössische Kunst auf der Leipziger Baumwollspinnerei in der Ausstellung 14 presents 14 die prämierten Titel des internationalen Wettbewerbs Best Book Design from all over the World / Schönste Bücher aus aller Welt 2025. Das Ausstellungsprojekt reiht sich ein in die internationalen Präsentationen in Frankfurt, Reykjavík, Kopenhagen und Helsinki.
Auch die 21 Bücher auf der Shortlist, die eine Auszeichnung nur knapp verfehlten, sind zu sehen.
Begleitend zur Ausstellung findet am 3. Juni 2025 ein Buchgespräch statt: Der prämierte Ausstellungskatalog Size Matters wird vom Gestaltungsbüro HIT, dem Distanz Verlag und der Stiftung Buchkunst vorgestellt, außerdem gibt es Einblicke in die zeitgenössische Konzeption von Fotobüchern sowie deren Entstehungs- sowie Gestaltungsprozesse.
© Visual: HALLE 14 – Zentrum für zeitgenössische Kunst / Grafikerin: Kristina Brusa. © Foto: Stiftung Buchkunst / Foto: Bo He

BSB München: Farben Japans
bis 6. Juli 2025
Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek
Bayerische Staatsbibliothek, Ludwigstraße 16, 80539 München
Schatzkammern, Prachttreppenhaus und Fürstensaal, 1. OG
Sonntag bis Freitag 10 bis 18 Uhr
Die Ausstellung präsentiert rund 130 Meisterwerke des japanischen Farbholzschnitts aus dem Bestand der Bibliothek: von den Anfängen des Mehrfarbendrucks in der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zu shin-hanga, den sogenannten Neuen Drucken des 20. Jahrhunderts. Darunter befinden sich aufwändig illustrierte Bücher, seltene Triptychen oder Einblattdrucke wie Hokusais weltberühmtes Werk Unter der Welle im Meer vor Kanagawa, bekannt als Große Welle. Diese Ikone der Kunst konnte in den vergangenen Jahren ebenso wie zwei weitere herausragende Werke Hokusais, Sommergewitter am Fuße des Berges und Südwind, klares Wetter, bekannt als Roter Fuji, für die Sammlung erworben werden. Alle drei Drucke stammen aus der berühmten Holzschnittserie Sechsunddreißig Ansichten des Berges Fuji, die ab 1830 erschienen ist. Die Drucke bilden ein Highlight der Ausstellung.
Weitere Informationen: BSB_Mü_FarbenJapans virtuell
Der Begleitband ist bei Kerber erschienen: 376 S., rund 190 farbige Abb., Klappenbroschur 24×30 cm, 48 €.
Bild: Ikeda Terukata (1883–1921), Hortensie aus dem Album Tausenderlei Blumen, 1898. © BSB L.jap. K 399
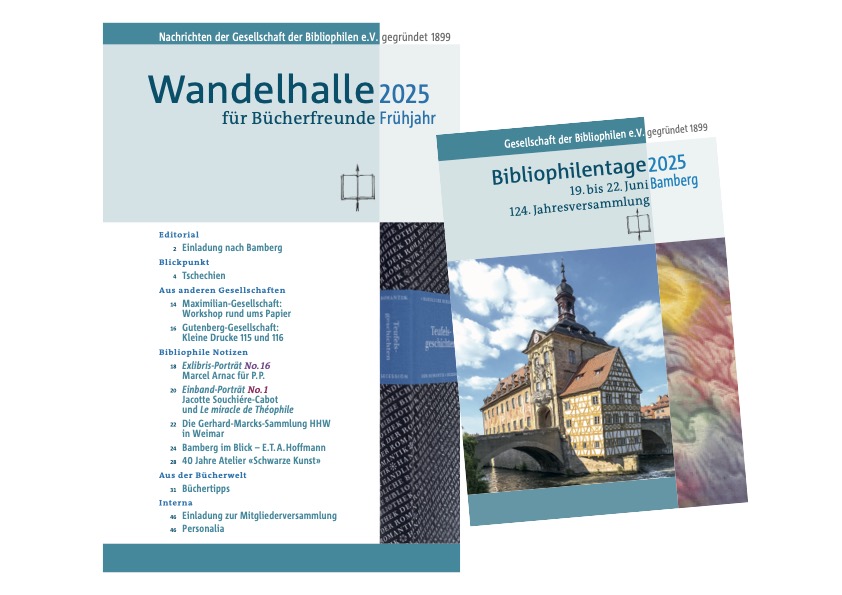
Wandelhalle und Tagungsheft 2025
Die Frühjahrsausgabe der Wandelhalle ist erschienen und an die Mitglieder verschickt worden. Sie enthält unter anderem Beiträge zur tschechischen Buchkunst, ein weiteres Exlibris-Porträt sowie den ersten Text einer neuen Reihe mit Einbandporträts.
Außerdem liegt ihr das Programmheft zum Jahrestreffen 2025 in Bamberg bei. Wie immer sind auch Gäste willkommen, die gern über die Geschäftsstelle Kontakt aufnehmen können.
Weitere Infos zum Jahrestreffen finden Sie in der Rubrik Begegnung/Jahrestreffen auf dieser Website:
Jahrestreffen2025
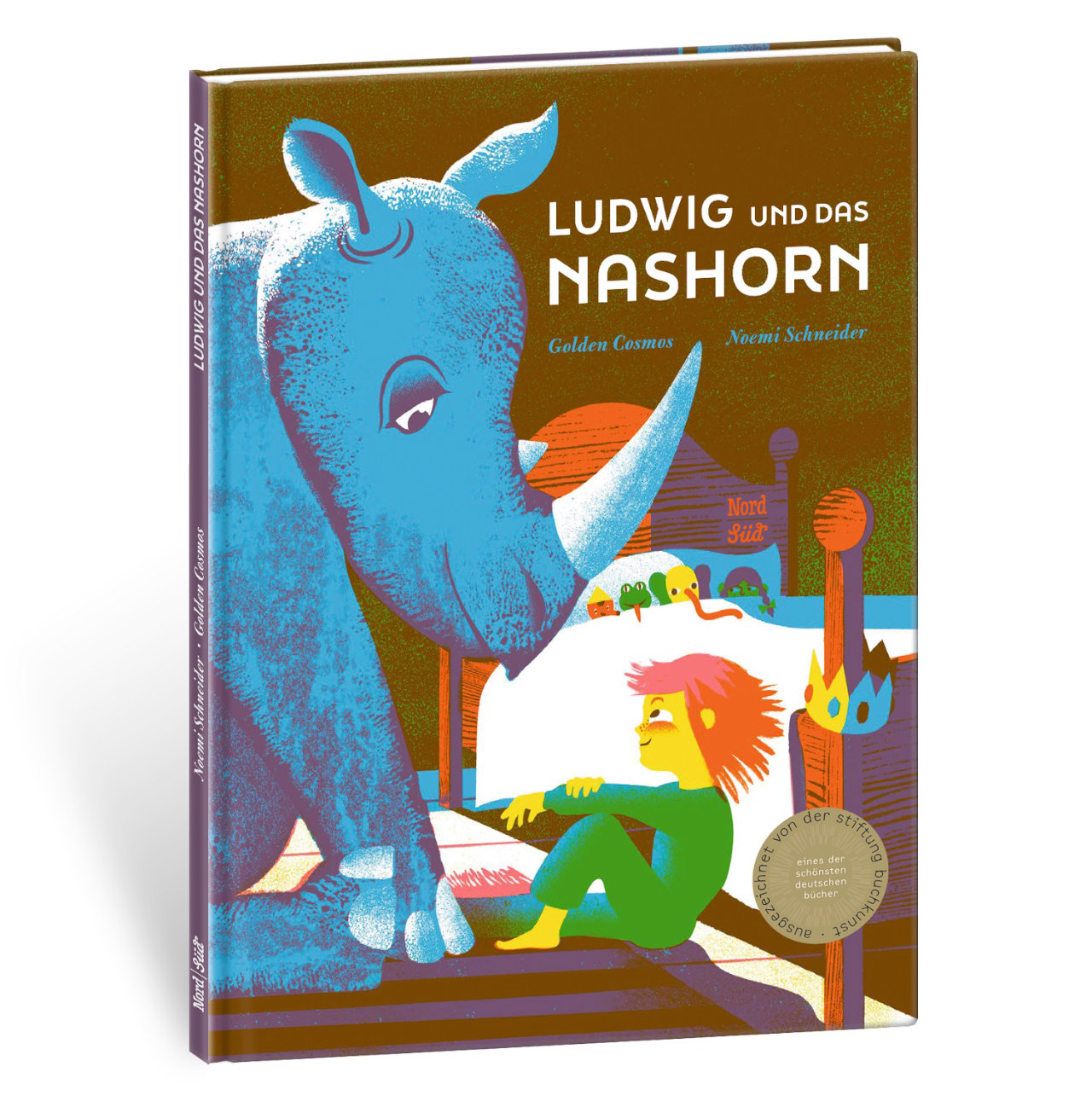
Troisdorfer Bilderbuchpreis für «Ludwig und das Nashorn»
Der Troisdorfer Bilderbuchpreis würdigt alle zwei Jahre herausragende Leistungen auf dem Gebiet der künstlerischen Bilderbuchillustration. 2025 geht der Preis an das Duo Golden Cosmos (Doris Freigofas and Daniel Dolz) für die Illustrationen zu Ludwig und das Nashorn, einer humorvollen Gute-Nacht-Geschichte für angehende Philosophinnen und Philosophen von Noemi Schneider, erschienen im NordSüd Verlag, Zürich, und bereits im Wettbewerb der Stiftung Buchkunst als eines der Schönsten deutschen Bücher 2024 ausgezeichnet.
Die Preisverleihung findet am 21. September 2025 in der Burg Wissem statt. Eine Auswahl der eingereichten Arbeiten ist bis zum 16. November im Museum zu sehen.
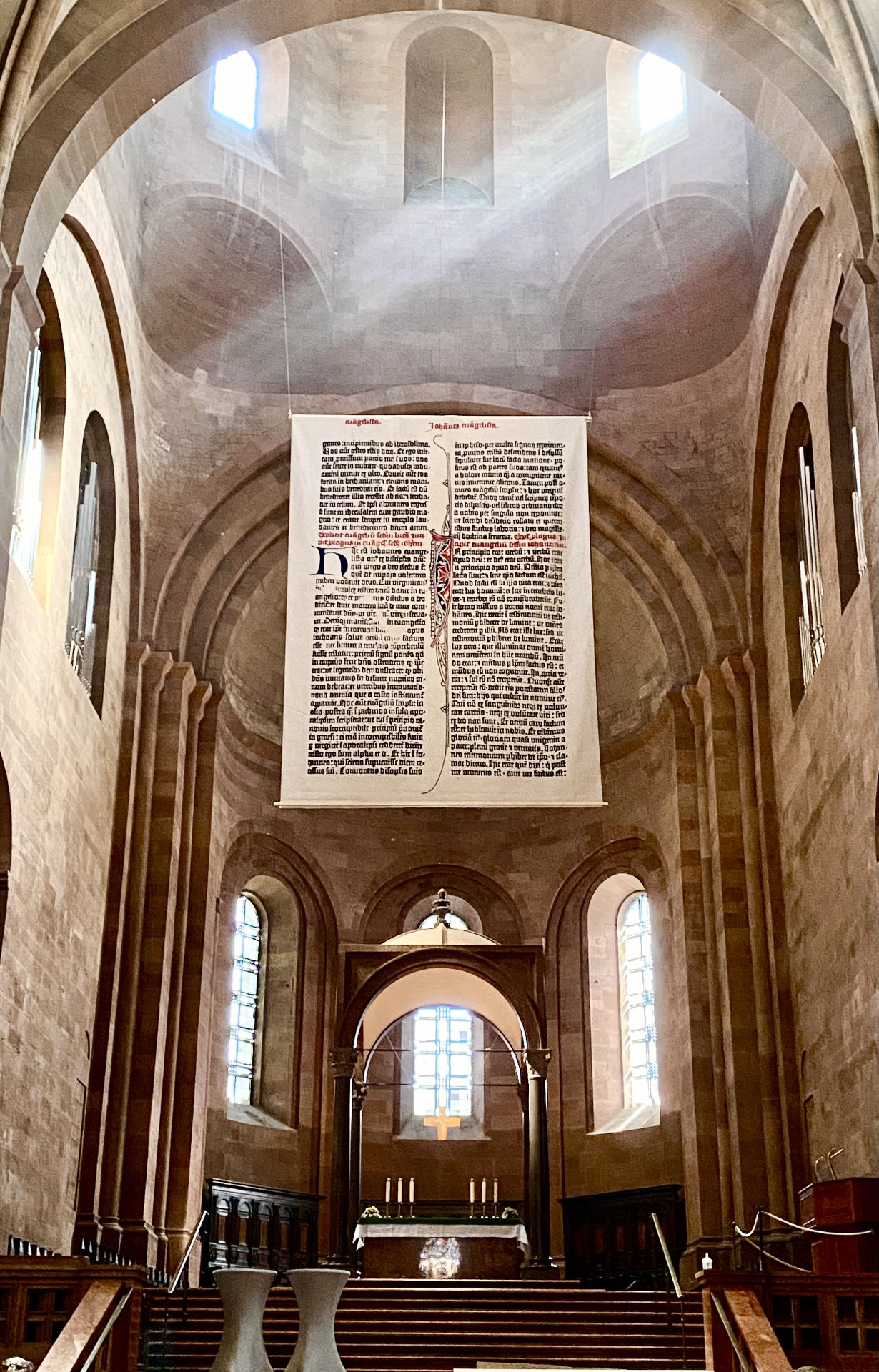
Weltweit größte Bibelseite nun im Mainzer Dom
Die weltweit größte Bibelseite wurde in einer spektakulären Aktion unter großem Publikums- und Medieninteresse am 26. und 27. April in Mainz gedruckt. Ein Exemplar hängt seit Montag, dem 28. April, im Mainzer Dom.
Foto: Markus Kohz
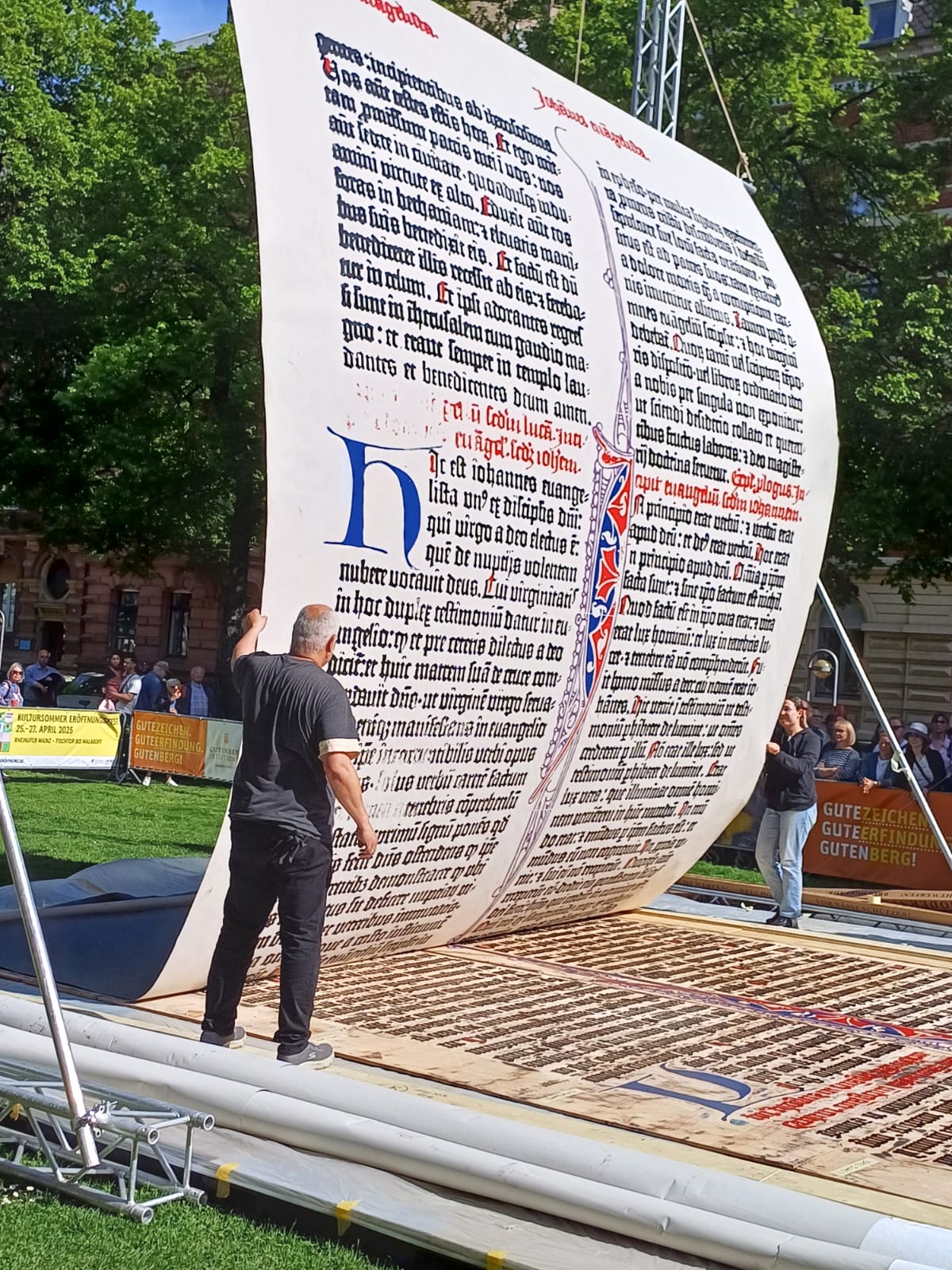
Weltweit größte Bibelseite gedruckt
… von langer Hand geplant und vorbereitet, erfolgte am 26. und 27. April 2025 der Druck der größten Bibelseite weltweit …

Rekordversuch: Druck der weltweit größten Bibelseite
26. und 27. April 2025
Weltrekordversuch in Mainz:
Druck der größten Bibelseite der Welt
Fischtorplatz, Mainz
Samstag zwischen 14 und 16:30 Uhr
Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr
Dieses Jahr feiert die Internationale Gutenberg-Gesellschaft in Mainz den 625. Geburtstag von Johannes Gutenberg – mit einem Weltrekordversuch!
Im Rahmen der feierlichen Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz wird auf dem Fischtorplatz ein monumentaler Hochdruck entstehen: Die erste Seite des Johannes-Evangeliums aus der Gutenberg-Bibel (Shuckburgh-Exemplar) wird im Format 5×7,20 Meter gedruckt – am Samstag zunächst mit schwerem Gerät und gegen 16 Uhr im Beisein politischer Prominenz, am Sonntag dann gemeinsam mit dem Publikum.
Ab Montagmittag wird die Seite im Mainzer Dom hängen.
Die Idee und Umsetzung stammen von Markus Kohz, einem engagierten Mitglied im Vorstand der Gutenberg-Gesellschaft.
Foto: Markus Kohz
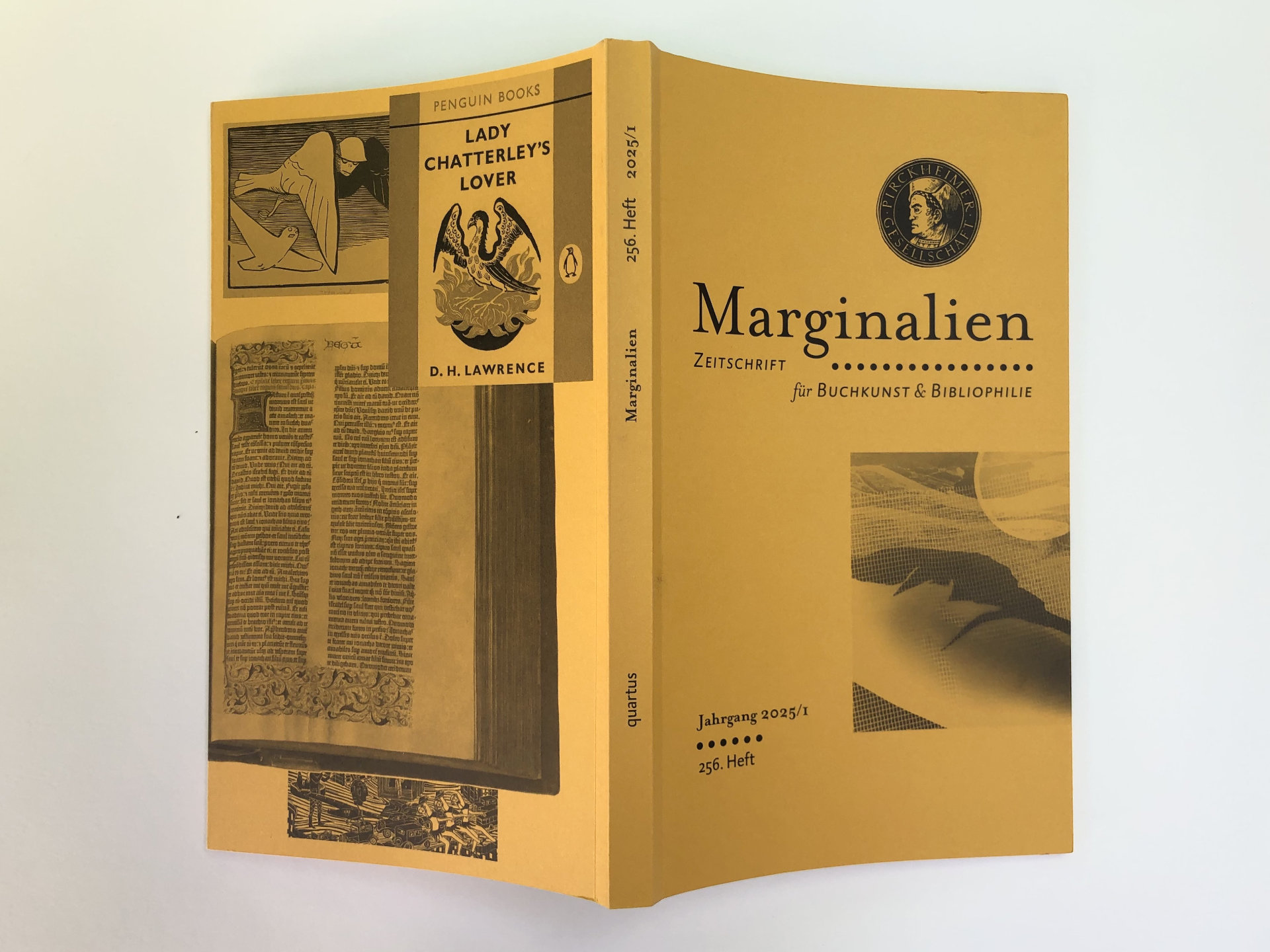
«Marginalien» in neuer Gestaltung
Wandelbar zeigen sich die Marginalien. Zeitschrift für Buchkunst & Bibliophilie der Pirckheimer-Gesellschaft. Ihre erste Ausgabe 2025 tritt im vertrauten Format auf und doch ist einiges anders als bisher. Auf dem sonnengelben Umschlag erscheinen nun illustrative Elemente (die auf Beiträge im Inneren verweisen) und neue Satzschriften in abgewandelter Typografie. Nach zehn Jahren hat Matthias Gubig, feinsinniger Typograf und hintersinnig-humorvoller Illustrator, als Gestalter der Marginalien den Staffelstab an Thomas Glöß weitergegeben. Dieser, Typograf und Dozent, zudem langjähriger Vorsitzender des Leipziger Bibliophilen-Abends, bringt behutsam einen neuen Klang in die Zeitschrift, setzt eigene Akzente. In gewohnt hoher Qualität.
Der Inhalt ist bewährt vielseitig. Roland Jaeger widmet sich dem Berliner Gebrauchsgrafiker Hermann Seewald (1901–1977). Matthias Haberzettl macht eine bemerkenswerte «biografische Randbemerkung» zu Werner Klemke, bei der Hans Schmoller (Penguin Books, London) und der Ehrentitel «Honorary Royal Designer for Industry» (Hon. R. D. I.) eine besondere Rolle spielen. Wie sich der Umgang mit Kunst im Lesebuch wandelte, beschreibt Gisela Teistler. Rainer Schmidt befasst sich mit Johannes Gutenberg. Im ABC der Druckkunst geht es diesmal um das Fotogramm (Uwe Klos), als Fundsache wird die 400-jährige Reise eines Buches durch Europa skizziert (Maria Bogdanovich) – es geht um ein Exemplar der Respublica sive status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc., 1642 als einer von 35 Bänden des weltweit ersten Länderführers bei Elsevier in den Niederlanden erschienen – und in der Reihe Das besondere Blatt treffen Gerhard Marcks und Georg Hirsch aufeinander (Gerhard Rechlin). Christian Ewald und einen besonderen Druck aus seiner Katzengraben-Presse würdigt Helmut Garritzmann und inwieweit die MaroHefte «bebilderte Wagnisse» liefern, erläutert Till Schröder. Nicht zu vergessen die Typografische Beilage: «InMITTen», Gedichte, zentriert versammelt von Jürgen Engler und im schönsten Bodoni-Mittelachsensatz in Szene gesetzt von Thomas Glöß.
Fazit: Auch im neuen Look bieten die Marginalien hohe Qualität, inhaltlich wie gestalterisch.
Foto: Silvia Werfel
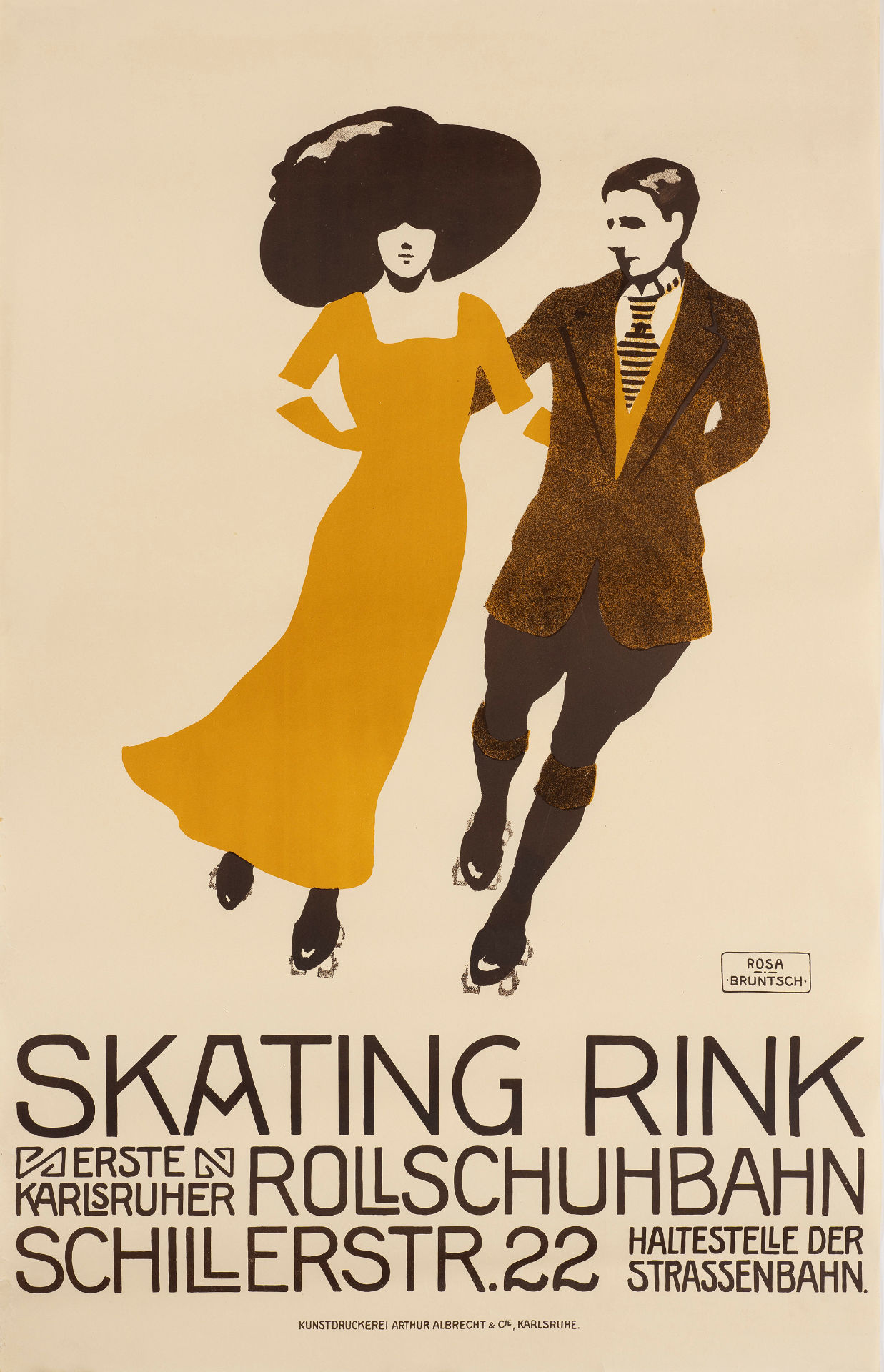
Verlängert: «Plakatfrauen. Frauenplakate»
bis 15. Juni 2025 verlängert!
Plakatfrauen. Frauenplakate
Hessisches Landesmuseum für Kunst und Natur
Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden
Die Ausstellung zur Plakatkunst des Jugendstils nimmt in zweifacher Hinsicht die Frauen in den Blick: als beliebtes Motiv in der Plakatwerbung seit Anfang des 20. Jahrhunderts sowie als professionelle Gestalterinnen in einem männlich dominierten Berufsfeld.
Mehr Informationen finden Sie in der Notiz vom Oktober 2024.
Bild: Rosa Bruntsch, Skating Rink [erste Karlsruher Rollschuhbahn], Farblithografie 1910. Plakatsammlung Maximilian Karagöz. Foto: Museum Wiesbaden/Bernd Fickert
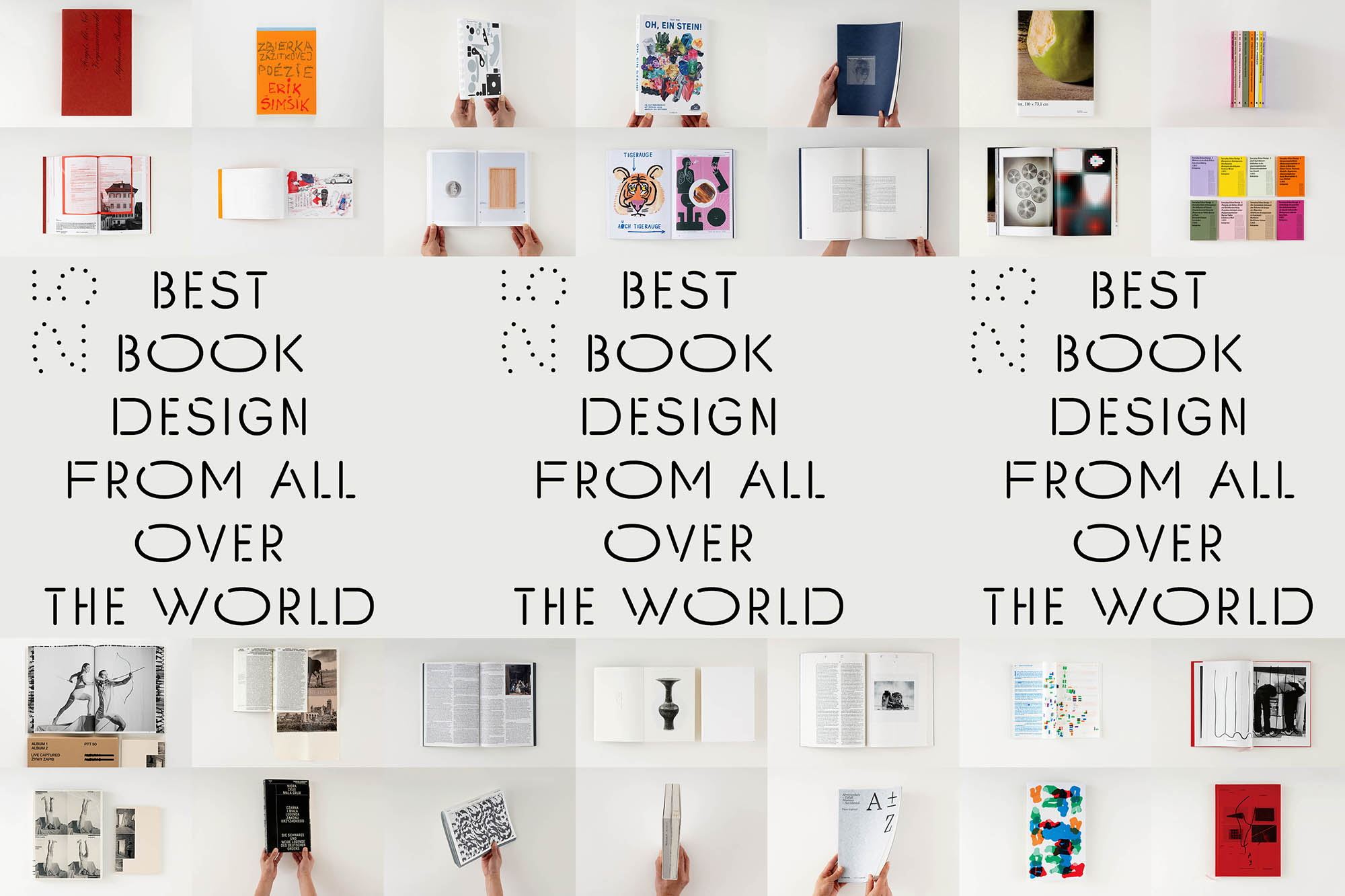
Die «Schönsten Bücher aus aller Welt» 2025 sind prämiert
Die Goldene Letter, die von der Jury als höchste Auszeichnung vergeben wird, geht 2025 an die Publikation Forget Me Not / Vergissmeinnicht, die zuvor im niederländischen Buchgestaltungswettbewerb ausgezeichnet wurde. Erschienen ist der Titel bei Building Fictions, Amsterdam, gestaltet wurde das Buch von Rudy Guedj.
Dreizehn weitere Auszeichnungen – eine Goldmedaille, zwei Silbermedaillen, fünf Bronzemedaillen und fünf Ehrendiplome – gingen an Bücher aus China, Deutschland, Finnland, Österreich, Polen, Portugal, aus den Niederlanden, der Schweiz und der Slowakei. Die 21 Bücher auf der Shortlist verfehlten eine Auszeichnung nur knapp.
Die Auszeichnungen sind undotiert und sollen den internationalen Dialog in der Buchgestaltungszene anregen. Alle eingereichten Bücher sind zuvor bereits in den nationalen Wettbewerben ihrer Herkunftsländer prämiert worden. Rund 550 Bücher aus 32 Nationen waren diesmal zu bewerten. Zur fünfköpfigen Jury gehörten Shin Akiyama, Giulia Boccarossa, Birna Geirfinnsdóttir, Ákos Polgárdi und Astrid Seme.
Die Publikation zu Best Book Design from all over the World 2025 hat das Designstudio Hesign gestaltet. Zu sehen sind die weltweit schönsten Bücher unter anderem auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt am Main.
Übersicht der prämierten Bücher hier zum Download:
BBDW25_de_praemierte
© Stiftung Buchkunst / Visuals: Hesign

MAK Frankfurt: Text & Spirit
13. März bis 22. Juni 2025
Text & Spirit. Erleuchtungsgrafik.
Mittelalterliche Handschriften zwischen Alltagspraxis, Luxus und Glaube
Museum Angewandte Kunst Frankfurt
Schaumainkai 17, 60594 Frankfurt am Main
Erstmals zeigt das Museum Angewandte Kunst in der Ausstellung Text & Spirit seinen vollständigen Bestand spätmittelalterlicher illuminierter Handschriften. Es handelt sich dabei um Bücher und Fragmente mit feinster Buchmalerei und dekorativer Ausstattung aus Gold, Lapislazuli oder Purpur. Was können wir heute mit den Stundenbüchern aus dem Mittelalter anfangen? Text & Spirit beleuchtet verschiedene Schnittstellen zwischen damals und heute und dringt zum Vergleich zwischen den früheren Stundenbüchern mit den heutigen Smartphones vor – als «Lebensbegleiter» sind sie sowohl Kommunikationsmedien als auch Prestigeobjekte, ihre Benutzung führt dazu, sich aus dem unmittelbaren Hier und Jetzt gedanklich zu lösen, um sich im Geiste einzukapseln. Die Ausstellung möchte damit eine Neupositionierung der mittelalterlichen Stundenbücher auf der Grundlage des 21. Jahrhunderts als digital-kommunizierendes Zeitalter vornehmen.
Text & Spirit ist im Rahmen eines Digitalisierungsprojekts des Dezernats für Kultur und Wissenschaft der Stadt Frankfurt am Main entstanden. Das Museum Angewandte Kunst hat für das Digitalisierungsprojekt aus seiner Sammlung solche Kunstwerke ausgewählt, die aufgrund ihrer Empfindlichkeit sowie außergewöhnlicher Kostbarkeit bisher selten oder noch nie ausgestellt und erforscht worden sind: spätmittelalterliche illuminierte Handschriften, darunter Psalter, Breviere, Gesangs- und Stundenbücher. Diese kamen aus den bürgerlichen Privatsammlungen der Brüder Michael (1830–1892) und Albert Linel (1833–916) sowie Wilhelm Peter Metzler (1818–1904) an das Museum.
Hier geht es zu den Digitalisaten:
mak-frankfurt_sammlung_digital
Foto: Günzel/Rademacher © Museum Angewandte Kunst

MAK Frankfurt: Der Palast des typografischen Mauerwerks
bis 11. Mai 2025
Der Palast des typografischen Mauerwerks
Museum Angewandte Kunst Frankfurt
Schaumainkai 17, 60594 Frankfurt am Main
Zeichen, Symbol und Ornament, Konstruktion, Poetik und Spiel, Ordnung, Handwerk und Praxis – anhand dieser neun Kriterien blickt der niederländische Grafikdesigner Richard Niessen aus seiner praktischen Perspektive auf die Disziplin des Grafikdesigns. Am Beispiel seiner eigenen Sammlung visueller Artefakte aus unterschiedlichsten zeitlichen und kulturellen Zusammenhängen, analysiert er gestalterische Mittel, Methoden und Werkzeuge sowie die räumlichen und zeitlichen Kontexte gestalterischer Praxen. Daneben richtet er den Blick auf das Spannungsfeld zwischen Gestalter:innen, Auftraggeber:innen und Publikum und fragt nach der gesellschaftlichen Wirkmacht des Grafikdesigns.
Um seine Praxisforschung in eine Ausstellung zu überführen, nutzt Niessen das erzählerische Potenzial des Grafikdesigns und entwickelt die imaginäre Architektur eines Palastes, den Palast des typografischen Mauerwerks. Seine neun Kriterien bilden dabei die neun Abteilungen des Palastes, die sich über drei fiktive Etagen erstrecken und in denen sich Räume, Flügel, Korridore und Kammern entfalten. Sie werden als «Setzkästen» inszeniert, in denen die Exponate in den Dialog treten und neue Zusammenhänge sichtbar machen.
Foto: Günzel/Rademacher © Museum Angewandte Kunst
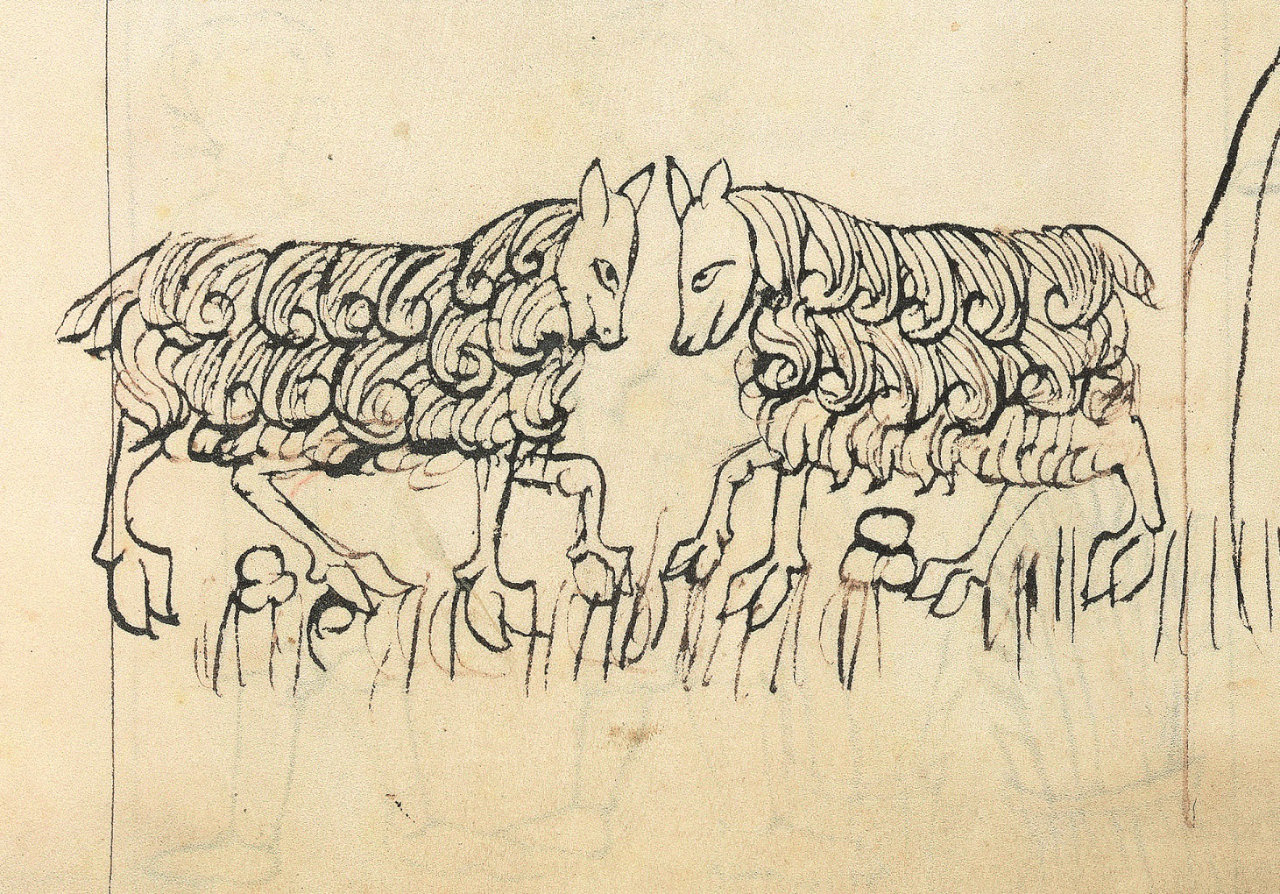
Landesbibliothek Oldenburg: «Dies fromme Wollen-Thier»
bis 26. April 2025
«Dies fromme Wollen-Thier»
Die Welt des Schafes in Bücherschätzen aus acht Jahrhunderten
Landesbibliothek Oldenburg, Pferdemarkt 15, 26121 Oldenburg
Das Schaf ist robust, genügsam, standorttreu und gehorsam. Diese Eigenschaften hat sich der Mensch seit Jahrtausenden zu Nutzen gemacht. Milch, Wolle und Dung lieferten Grundstoffe für Nahrung, Kleidung und Dünger. Aus dem Fett stellte man Talglichter her, aus den Knochen Leim, aus den Därmen Saiten. Knochen und Horn wurden zu Werkzeugen und Musikinstrumenten, die Häute zu Zelten, Weinschläuchen und Büchern. Kein anderes Haustier hat für die Geschichte der Menschheit eine so große Bedeutung.
Die von Drs. Hans Beelen (Universität Oldenburg) erarbeitete Ausstellung stellt in neun Kapiteln die Welt des Schafes in kulturhistorischer Perspektive dar. Anhand von fünfzig Buchexponaten aus den Beständen der Landesbibliothek Oldenburg und Wollobjekten aus Leihgaben wird die Beziehung zwischen Schaf und Mensch beleuchtet. Schwerpunkte sind dabei die Schafsymbolik, das Hirtenleben als Idylle und Realität sowie die Geschichte der Schafhaltung in Oldenburg und Umgebung.
Bild:
Entlaufene Schafe im Oldenburger Sachsenspiegel (14. Jh.). © Landesbibliothek Oldenburg

Berlin: Caspar David Friedrich – Found in Translation
bis 9. April 2025
Caspar David Friedrich – Found in Translation
Hegenbarth Sammlung Berlin, Laubacher Straße 38, 14197 Berlin
geöffnet mittwochs 12 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung
Aus Anlass des 250. Geburtstages von Caspar David Friedrich (1774–1840) zeigt die Hegenbarth Sammlung Berlin Papierarbeiten des Romantikers aus dem eigenen Bestand in Gegenüberstellung mit historischen und zeitgenössischen Darstellungen. Der Fokus liegt auf dem zeitlichen und kulturellen Transfer des Motivs Landschaft. Die ausgewählten Arbeiten sind zwischen dem 15. Jahrhundert und dem Jahr 2024 entstanden. Der Kunsthistoriker und Kurator der Ausstellung Johannes Rößler hat im Rahmen der Ausstellung als Mitherausgeber die neu edierten Briefe und Schriften Caspar David Friedrichs in der Hegenbarth Sammlung Berlin vorgestellt.
Der Ausstellungstitel Caspar David Friedrich – Found in Translation ist eine spielerische Anlehnung auf den 2003 entstandenen Film Lost in Translation (Regie: Sofia Coppola). In der Gegenüberstellung geht es um Transformation sowie Übersetzung im Bereich der Landschaftsdarstellung innerhalb der europäischen Kunstentwicklung und im Bezug auf ausgewählte japanische Kunstpositionen des 15. und 21. Jahrhunderts.
Den Auftakt machen die beiden jüngsten Arbeiten des Dresdener Künstlers Thomas Baumhekel (geb. 1963), die er mit Verweis auf die beiden hier ausgestellten Hauptmotive von Friedrich anfertigte. Mit breitem Pinsel und schwarzer chinesischer Tusche schrieb er auf großformatige Blätter die kalligraphischen Zeichen für Wald und Wurzel.
Mit Adrian Zingg (1734–1816), August Kopisch (1799–1853) und Heinrich Stuhlmann (1803–1883) sind drei Zeitgenossen Friedrichs vertreten. Josef Hegenbarth (1884–1962) schuf eine Vielzahl von Landschaften in verschiedenen Techniken (Leimfarben und Tuschfederzeichnungen) und unterschiedlichen Kontexten (von landschaftlichen Illustrationen bis heimatliche Ausflugsziele der Umgebung). Max Ernst (1891–1976) schuf 1954 eine farbgewaltige, surreale Decalcomanie. Nur wenige Jahre später entstand Karl Otto Götz’ (1914–2017) informelle Arbeit, die wie eine unbezwingbare Landschaft anmutet und vom Gestus her eine Brücke zu Thomas Baumhekels dynamisch gemalten Kalligraphien schlägt.
Experimente im Bildlabor
Freitag, 17. Januar 2025, 19 bis 21 Uhr
Mittwoch, 26. Februar 2025, 19 bis 21 Uhr
Mittwoch, 2. März 2025, 19 bis 21 Uhr
Künstlergespräch mit Thomas Baumhekel am
Mittwoch, 19. März 2025, 19 Uhr
Bild:
Ausstellungsansicht, Foto: Thomas Baumhekel

Leipzig: Zeit zu drucken 5
bis 6. April 2025
Zeit zu drucken 5
Ausstellung des Artist in Residence Programms 2024/25
Museum für Druckkunst, Nonnenstraße 38, 04229 Leipzig
Zu sehen sind die Werke der jeweils vierwöchigen Arbeitsaufenthalte von Andrea Ackermann, Chie Mori, Franziska Neubert und Stefanie Neumann. Die vier Künstlerinnen realisierten zwischen Oktober 2024 und Februar 2025 ihre druckgrafischen Ideen mittels Radierung, Linol- und Holzschnitt sowie typografisch. Das Programm wurde vom Museum für Druckkunst bereits zum fünften Mal gemeinsam mit der Giesecke+Devrient Stiftung durchgeführt.
Bild:
Andrea Ackermann schuf mit Kompositionen aus Farbe, Flächen und Linien weite Wasserlandschaften des Nordens. Foto © Museum für Druckkunst

HAB: Drei Bände des Wiener Bibliothekars und Kunstsammlers Moriz Grünebaum restituiert
Die Herzog August Bibliothek (HAB) hat eine dreibändige Ausgabe von Friedrich Nicolais satirischem Roman Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker restituiert.
Moriz Ritter von Grünebaum (1873–1942) war trotz seiner Konversion zum Katholizismus nach der Eingliederung Österreichs ins Deutsche Reich im März 1938 antisemitischen Verfolgungen durch das NS-Regime ausgesetzt. In Vorbereitung seiner Zwangsumsiedlung in eine sogenannte Sammelwohnung musste der leidenschaftliche Exlibris-, Grafik- und Büchersammler seine umfassende Sammlung im Herbst 1940 bei der Spedition J. Z. Dworak junior einlagern.
Im August 1942 wurde Moriz Grünebaum ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er am 21. Dezember 1942 im Alter von 69 Jahren verstarb. Über den weiteren Verbleib seiner Sammlung ist nichts bekannt. Zwischen 1948 und 1957 tauchten sukzessive Werke aus Grünebaums Eigentum im Wiener Kunsthandel auf. Wann und auf welchen Wegen die Stücke in den Handel gelangten, ist heute nicht mehr nachvollziehbar.
Die dreibändige Ausgabe von Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker kam als Teil der Bibliothek des Komponisten und Hochschullehrers Ernst Pepping (1901–1981) 1985 in den Bestand der HAB. Seine etwa 2300 Bände umfassende Sammlung von Werken der deutschen und europäischen Literatur in historischen Ausgaben stellte Pepping eigenen Aussagen zufolge seit der Nachkriegszeit zusammen. Ein Erwerb einzelner Bände während der NS-Zeit ist jedoch nicht auszuschließen.
Die Provenienz der Bände aus dem Eigentum von Moriz Grünebaum wurde im Rahmen des vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste geförderten Projekts NS-Raubgut unter den Zugängen der Herzog August Bibliothek 1933–1969 recherchiert. Ihr NS-verfolgungsbedingter Entzug kann als gesichert gelten, weshalb die HAB die Bücher nun an die Erbberechtigten des Sammlers restituiert hat.
Mehr Informationen zu Moriz Ritter von Grünebaum hier:
Lexikon_provenienzforschung_gruenebaum
Bild:
Exlibris von Moriz Grünebaum, anhand dessen die Besitzhistorie rekonstruiert werden konnte. © Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
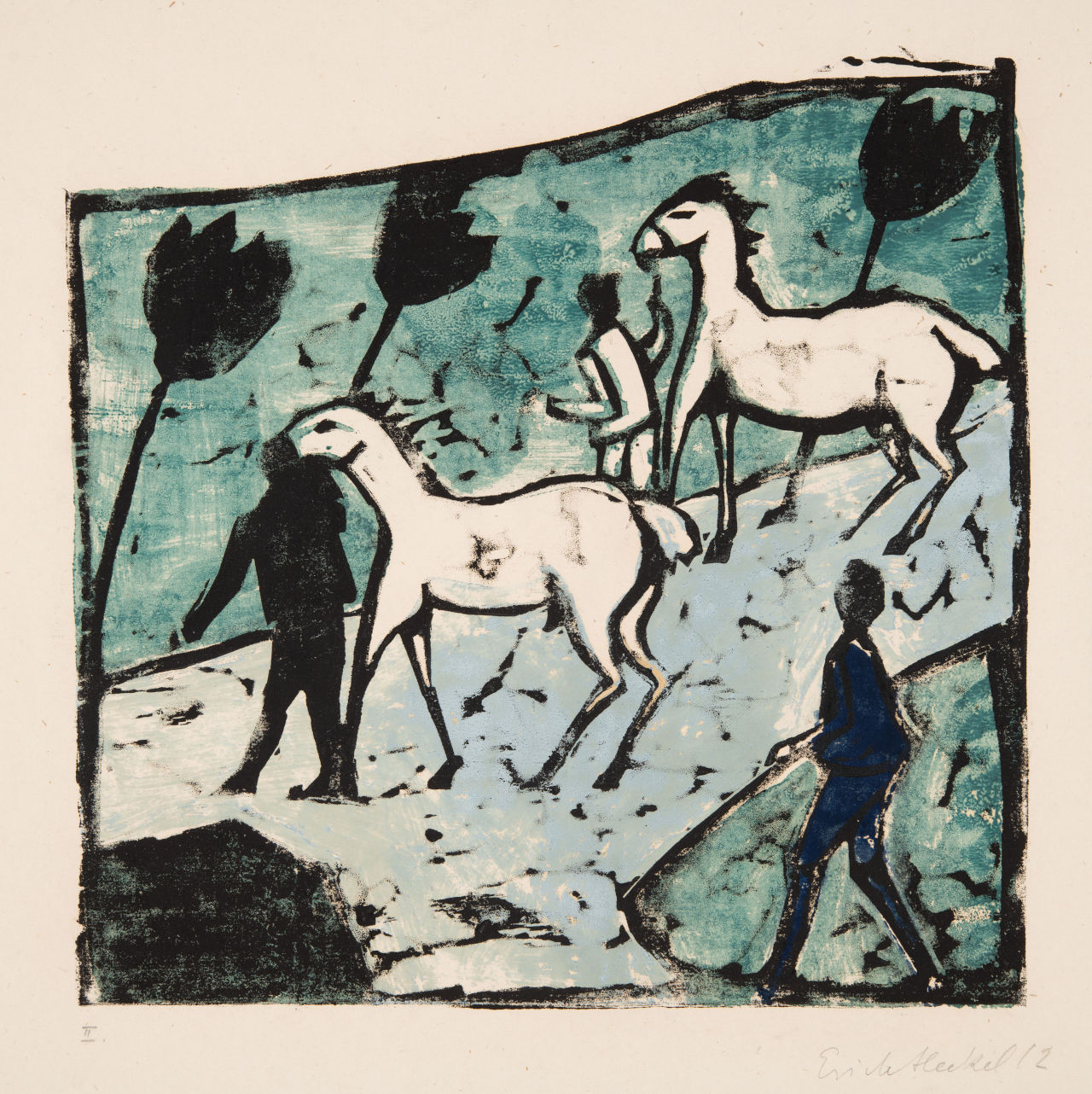
Weiße Pferde und Schützengräben im Kupferstich-Kabinett Dresden
bis 16. März 2025
Weiße Pferde und Schützengräben.
Expressionisten neu gesammelt
Kupferstich-Kabinett im Residenzschloss,
Taschenberg 2, 01067 Dresden
Seit 2018 beherbergt das Kupferstich-Kabinett die Stiftung Dr. Kurt und Annelore Schulze († 2004 und 2023). In der Sammlung des Hamburger Ehepaars sind drei Künstler mit Dresden-Bezug besonders prominent vertreten: Karl Schmidt-Rottluff (1884 –1976) und Erich Heckel (1883–1970) gehörten der Dresdner Künstlergemeinschaft Brücke an, Otto Dix (1891–1969) war Gründungsmitglied der Dresdner Sezession Gruppe 1919 und von 1927 bis 1933 Professor an der Dresdner Kunstakademie.
Die Schau im Kupferstich-Kabinett präsentiert Highlights dieser drei Künstler im Dialog mit expressionistischen Werken aus dem eigenem Bestand. Das Spektrum an Themen reicht dabei von den utopisch gestimmten Anfängen der Bewegung – für die sinnbildlich Heckels Weiße Pferde stehen können – bis hin zu den traumatischen Erlebnissen des Ersten Weltkriegs, wie sie Dix’ Skizzen von Kriegsverletzten und Schützengräben in schonungsloser Drastik vor Augen führen.
Nicht zuletzt spiegeln die Werk-Dialoge auch die Dezimierung des Dresdner Sammlungsbestands im Zweiten Weltkrieg. Allein im Kupferstich-Kabinett wurden im Zuge der NS-Aktion Entartete Kunst 381 Blätter beschlagnahmt – darunter vor allem expressionistische Werke, die nahezu alle als verloren gelten. Seit 1945 konnte unter großem Einsatz ein neuer Bestand an expressionistischen Blättern aufgebaut werden, mit dem die Neuzugänge der Stiftung Schulze nun zusammenklingen.
Bild:
Erich Heckel, Weiße Pferde (Schwemme), 1912. © Nachlass Erich Heckel, Hemmenhofen und Kupferstich-Kabinett, SKD, VG Bild-Kunst, Bonn 2024, Foto: Caterina Micksch

«Moderne Frauen» im Albertinum Dresden
bis 9. März 2025
Moderne Frauen / Women’s Art Rising.
Künstlerinnen des Fin de Siècle
Albertinum, Tzschirnerplatz 2, 01067 Dresden
Das Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) hat sich auf eine ebenso faszinierende wie fortdauernde Spurensuche begeben. Zwanzig Werke, darunter Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen und Grafiken von Frauen aus der Zeit um 1900, wurden im Rahmen wissenschaftlicher Forschung in den eigenen Beständen der SKD (wieder-)entdeckt und in die Sammlungspräsentation integriert. Dort begegnen sie den Werken männlicher Zeitgenossen auf Augenhöhe.
In der übergreifenden Sammlungspräsentation setzt das Albertinum nun die Werke von elf Frauen in Szene, die vor allem in Dresden, Leipzig oder Berlin tätig waren und verschiedene Kunstströmungen repräsentieren, insbesondere den Jugendstil und den Symbolismus. Die Malerin Julie Wolfthorn (1864–1944) griff mit ihrer Waldhexe etwa das Mythisch-Romantische der Epoche auf, Emilie Mediz-Pelikan (1861–1908) schuf märchenhafte, stille Landschaften und die Künstlerin Hildegard von Mach (1873-1950) bediente sich an tradierten Bildmotiven und entwarf Plakate von großer Eindringlichkeit. Das Hochdekorative dieser Zeit äußert sich hingegen in verspielten Werken wie Mathilde Ades (1877–1953) Illustration Eine moderne Küche während Gemälde wie das Selbstbildnis als stehender Akt von Paula Modersohn-Becker (1876–1907) sinnliche Körper- und Weiblichkeit zelebrieren. Gezeigt werden zudem Arbeiten von Jenny von Bary-Doussin (1874–1922), Marianne Fiedler (1864–1904), Julie Genthe (1869–1938), Marie Gey-Heinze (1881–1908), Cornelia Paczka-Wagner (1864 bis wohl 1943) und Lilli Wislicenus-Finzelberg (1872–1939).
Begleitend zur Präsentation erscheint zudem der Katalog Moderne Frauen. Künstlerinnen des Fin de Siècle im Sandstein Verlag, herausgegeben von den SKD und Andreas Dehmer, 80 Seiten, 16 €.
Bild:
Lilli Wislicenus-Finzelberg, mit Bismarckfigur in ihrem Atelier, um 1913. © Stadtmuseum und -archiv Andernach
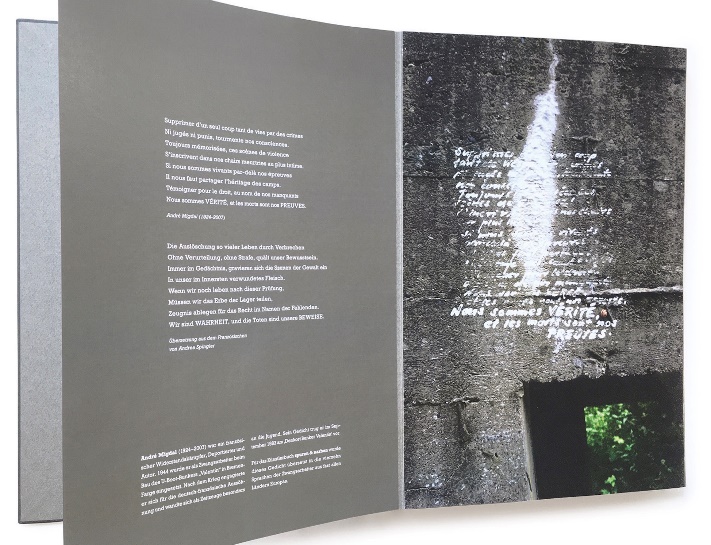
Landesbibliothek Oldenburg: Retrospektive Heike Ellermann
bis 22. Februar 2025
Retrospektive zum 80. Geburtstag der Künstlerin Heike Ellermann
Landesbibliothek Oldenburg, Pferdemarkt 15, 26121 Oldenburg
Anlässlich des 80. Geburtstages der Künstlerin zeigt die Landesbibliothek Oldenburg auch die Anfänge und einige ‹Nebenwege› ihres umfangreichen künstlerischen Werks. Ausgestellt werden Landschaftsaquarelle, die bis zu den ersten Bilderbüchern (ab 1987) einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Die Künstlerin bleibt dem Motiv Landschaft auch mit wechselnden Techniken (z.B. Ölpastell) treu. In den späteren abstrakten Arbeiten tauchen dann informelle Zeichen auf – bis hin zur Schrift, die unlesbar bleibt, aber wichtiges Gestaltungsmittel ist.
Als Autorin und Illustratorin von Bilderbüchern mit fünfzehn Veröffentlichungen von 1987 bis 2008 schafft Heike Ellermann ein eigenständiges Werk in der deutschen Kinderliteratur mit Nominierungen 1991 und 1999 für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Die Recherchen für das Bilderbuch Malte im Moor (1995; Text Irmtraud Rippel) inspirierte die Illustratorin zu einer Fotoarbeit: ausgestellt ist die achtteilige Fotoserie Räderwerk mit Motiven aus dem Moormuseum in Elisabethfehn.
Illustrationen & Objektkästen (2012) zu Gedichten der Lyrikerin Rose Ausländer (1901–1988) werden jetzt erstmalig in Oldenburg gezeigt. Sie bilden einen der erwähnten künstlerischen ‹Nebenwege›, zu denen auch eine weitere Fotoserie gehört: 20 Schaltkästen, aufgenommen 2010 im Weltkulturerbe Völklinger Hütte.
Bild:
Beitrag zur Erinnerungskultur: das Künstlerbuch spuren & narben. zeit.zeitzeugnisse zum Bunker Valentin in Farge/Bremen (2021) zu einem Gedicht von André Migdal (1924–2007), französischer Autor und ehemaliger Widerstandskämpfer, der als Zwangsarbeiter am Bunkerbau beteiligt war.

Antiquaria-Preis 2025 für Günter Karl Bose
Der mit 10 000 € dotierte, vom Verein Buchkultur e.V., der Stadt Ludwigsburg und der Wiedeking Stiftung Stuttgart gestiftete 30. Antiquaria-Preis für Buchkultur wird dem Verleger, Typografen und Buchgestalter Günter Karl Bose verliehen.
Der Preisträger «hat über Jahrzehnte die Buchkultur in Deutschland mit hohem Qualitätsgefühl und Ausstrahlung auf verschiedenen Feldern mitgestaltet und geprägt. Er trat als Verleger, Typograf und Buchgestalter sorgfältig gestalteter Bücher hervor, die in ihrer Verbindung von klassischen und modernen Gestaltungselementen als vorbildlich gelten dürfen. Zudem unterrichtete er 25 Jahre als Professor für Typografie an der traditionsreichen Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Zum dritten hat Günter Karl Bose als Autor von viel beachteten Monografien und Essays über Bücher, Buchstaben und zur Fotografie wichtige Beiträge zur Mediengeschichte vorgelegt.» (aus der Jurybegründung)
Die feierliche Preisverleihung findet am 23. Januar 2025 im «Podium» der Musikhalle Ludwigsburg statt (Beginn 20:15 Uhr). Die Laudatio wird Rudi Kienzle, Studiendirektor a.D. und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Literaturarchiv Marbach (1988–2014), halten.
Foto © Lu Antonia Bose
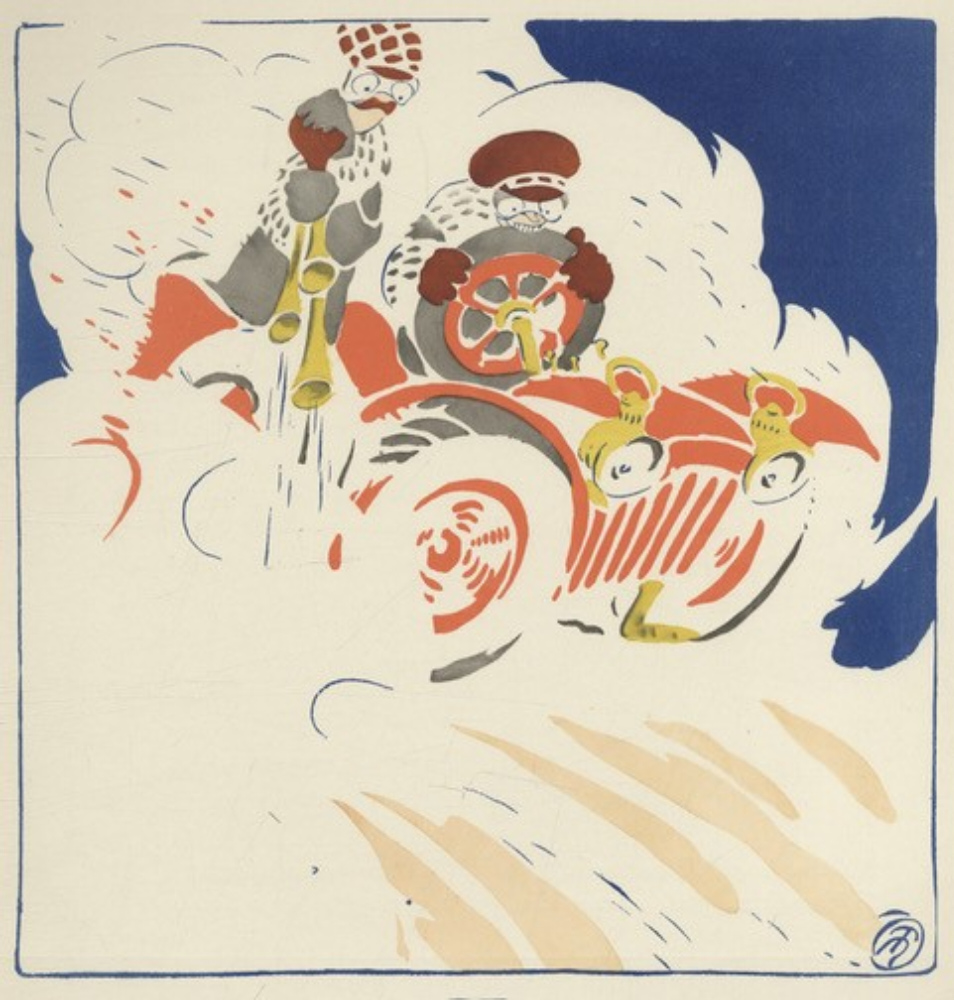
39. Antiquaria Ludwigsburg
39. Antiquaria – Antiquariatsmesse Ludwigsburg
23. Januar 2025: 15 bis 20 Uhr
24. Januar 2025: 11 bis 19 Uhr
25. Januar 2025: 11 bis 17 Uhr
Ort: Musikhalle Ludwigsburg, Bahnhofstraße 19, 71638 Ludwigsburg (gegenüber dem Bahnhof)
freier Eintritt für alle unter 39 Jahren
Rausch und Ekstase! Das Rahmenthema der diesjährigen Antiquaria klingt ungewöhnlich; aber gab und gibt es nicht das Bedürfnis, die Sinne zu erweitern oder Grenzen zu überschreiten? Ob Drogen-, Gold- oder Geschwindigkeitsrausch – die Antiquaria hält bemerkenswerte literarische Entdeckungen dazu bereit und sogar das Kinoplakat zu Charlie Chaplins berühmtem Film Goldrausch (Versandantiquariat Andanti, 3200 €). Die 53 Antiquarinnen und Antiquare aus Deutschland, Frankreich, Österreich und den Niederlanden haben aber auch alte Drucke, Autographen, Erstausgaben, Reiseberichte, Kinderbücher und vieles mehr im Angebot.
Der 30. Antiquaria-Preis zur Förderung der Buchkultur wird am Abend des Eröffnungstages im «Podium», Musikhalle Ludwigsburg verliehen (Beginn 20:15 Uhr). Dazu gibt es eine eigene Notiz.
Mehr Informationen:
Antiquaria_2025
Abbildung:
Antoinette Kahlers Kinderbuch Tobias Immerschneller ist von Richard Teschner illustriert (Farblithografien) und 1909 im Verlag der Wiener Werkstätten erschienen (Antiquariat Karajahn, 5000 €).
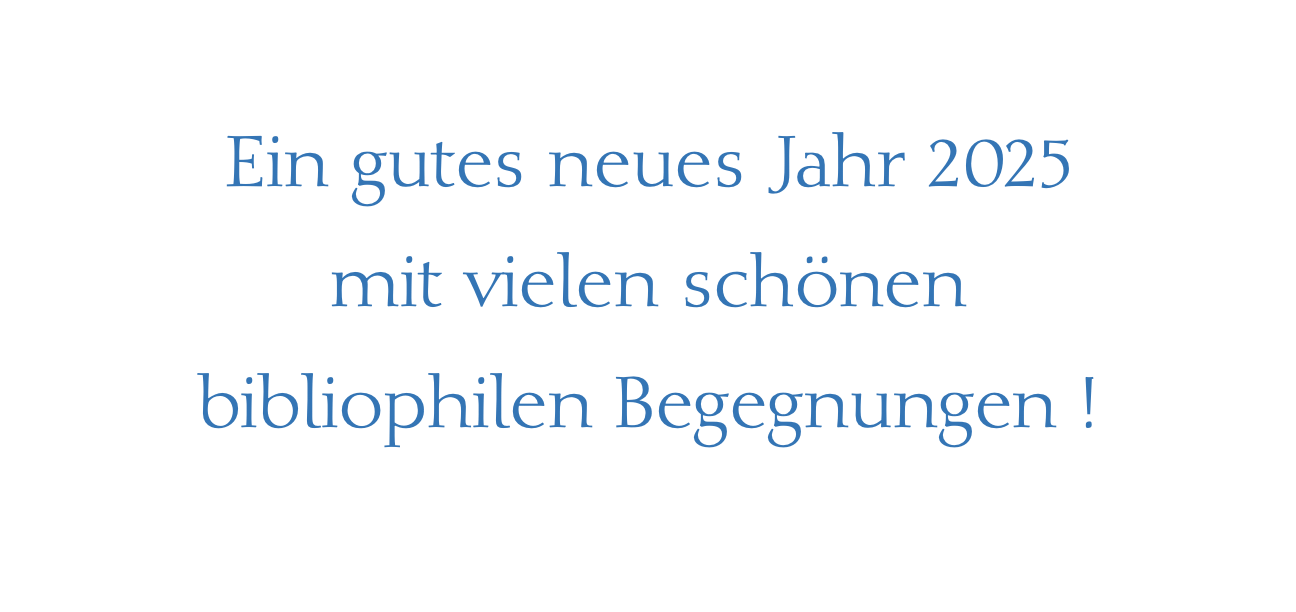
Bibliophile Neujahrsgrüße
(… gesetzt aus der Schrift Diotima von Gudrun Zapf von Hesse (1918–2019), entworfen1948, erschienen Anfang der 1950er Jahre als Bleisatzschrift bei D. Stempel Frankfurt am Main in den Schnitten kursiv und geradestehend; die 2008 zusammen mit Akira Kobayashi entwickelte digitalisierte Neubearbeitung unter dem Namen Diotima Classic umfasst acht Schriftschnitte …)
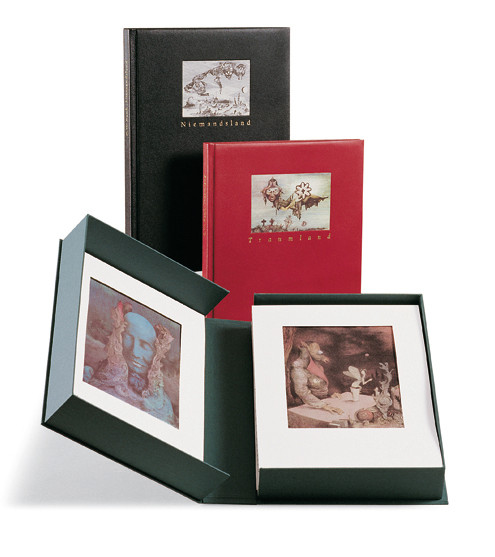
Landesbibliothek Oldenburg: 45 Jahre «The Bear Press»
30. November 2024 bis 1. Februar 2025
Über die Liebe zu Büchern. 45 Jahre «The Bear Press»
Landesbibliothek Oldenburg, Pferdemarkt 15, 26121 Oldenburg
Erlesene Texte, Handsatz, Buchdruck, Handeinbände, Originalgrafik – dies sind die Markenzeichen der seit 1979 von Wolfram Benda in Bayreuth betriebenen «Bear Press». Seit 45 Jahren veröffentlicht Benda hier in Handarbeit Pressendrucke und Einblattdrucke mit erlesenen Texten der (Welt-)Literatur von Lucian und Horaz bis zu H. C. Artmann und Ror Wolf, darunter zahlreiche Erstausgaben und Erstübersetzungen ins Deutsche. Jede Edition wird begleitet von Originalgrafiken renommierter Künstler wie Klaus Böttger, Uwe Bremer, Klaus Ensikat, Rolf Escher, Esteban Fekete, Gottfried Helnwein, Eberhard Schlotter, Hanns Studer oder Jan Peter Tripp.
Zur Eröffnung am Freitag, 29. November 2024, 18 Uhr, spricht der Verleger und Anglist Dr. Wolfram Benda über seine Arbeit, seine Ziele und die Herstellung von Künstlerbüchern in traditioneller Handarbeit. Kammerschauspielerin Elfi Hoppe liest aus seiner Übersetzung von William Beckfords Reiseberichten.
Bild: Caspar Walter Rauh, Niemandsland & Traumland, gesetzt aus der Dante-Antiqua. © www.thebearpress.de
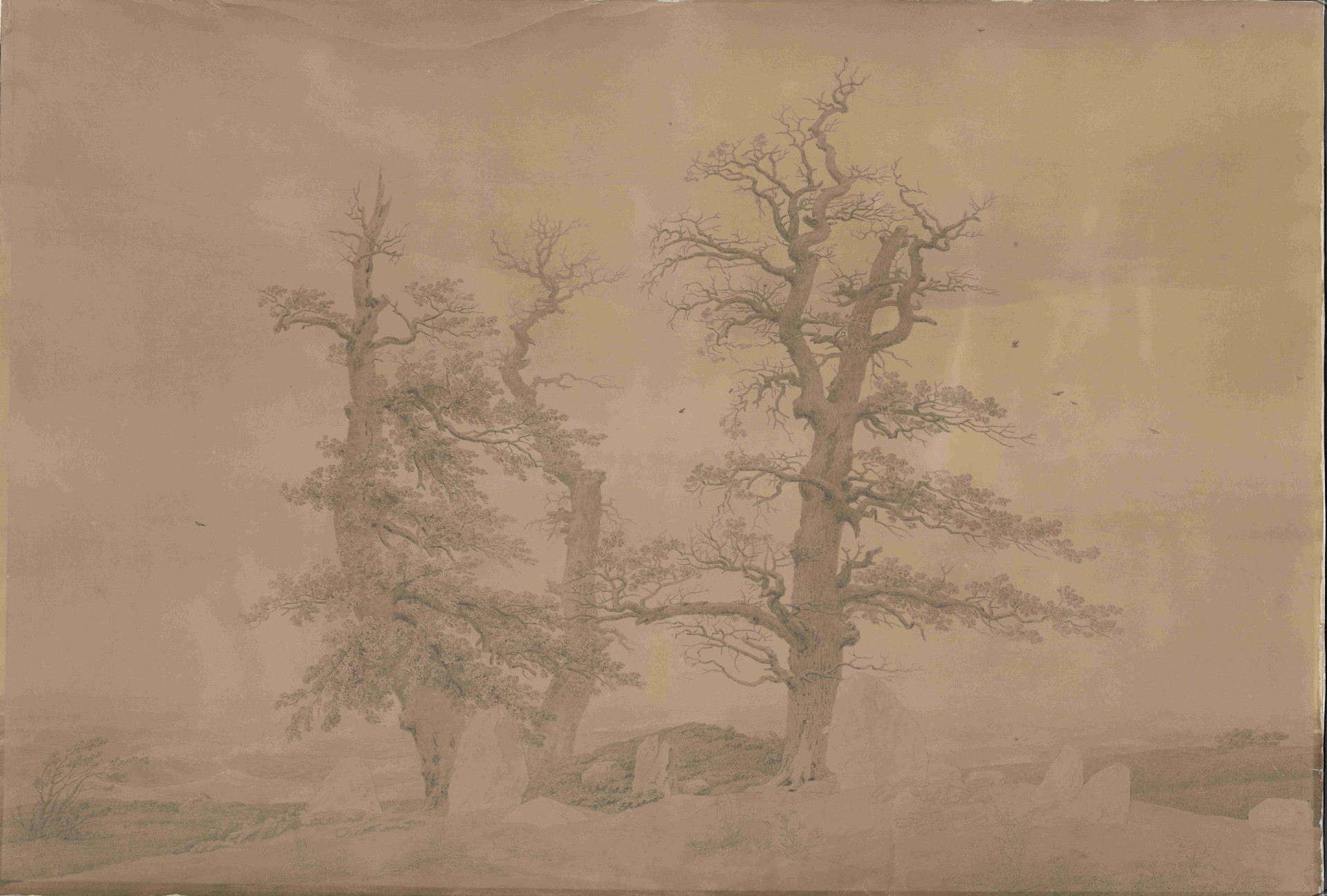
KSW: Caspar David Friedrich, Goethe und die Romantik in Weimar
22. November 2024 bis 2. März 2025
Caspar David Friedrich, Goethe und die Romantik in Weimar
Schiller-Museum, Schillerstraße 12, 99423 Weimar
Die am Abend des 21. November 2024 eröffnete Schau erfreut sich eines großen Publikumszuspruchs. Sie ist das Ausstellungshighlight der Klassik Stiftung Weimar zum Abschluss des großen Friedrich-Jubiläumsjahres.
Erstmals wird – auf zwei Etagen – der gesamte Weimarer Friedrich-Bestand gezeigt. Im Fokus steht der Beginn von Friedrichs künstlerischer Karriere sowie seine spannungsvolle Beziehung zu Johann Wolfgang von Goethe. Teil der Ausstellung sind auch das kürzlich gemeinsam mit Berlin und Dresden erworbene Karlsruher Skizzenbuch sowie eine neu entdeckte Zeichnung Caspar David Friedrichs aus Goethes Sammlung. Darüber hinaus wartet die Sonderausstellung mit neuen Kenntnissen zu Friedrichs Gemälden und Zeichnungen auf, wie dem bekannten Werk Huttens Grab. Alle Weimarer Friedrich-Werke wurden für die Ausstellung frisch restauriert und erforscht.
Annette Ludwig, Direktorin der Museen der Klassik Stiftung Weimar und Teil des Projektteams der Ausstellung: «Für den jungen Künstler Friedrich war die Verbindung nach Weimar sehr wichtig. Weimar mit der kunstrichterlichen Instanz Goethe war in dieser Zeit ein wichtiger Aushandlungsort für Kunst und für Friedrich gewissermaßen ein ‹Karriere-Booster›. Im Rahmen unserer Ausstellungsvorbereitung haben wir den Friedrich-Bestand und die Kontexte strategisch unter die Lupe genommen: kunsthistorisch, sammlungs- und provenienzgeschichtlich, restauratorisch und kunsttechnologisch. Daher können wir eine Vielzahl neuer Erkenntnisse, auch zu bislang ungelösten Fragen der Friedrich-Forschung, vorstellen.»
Zur Ausstellung erscheint der Katalog Caspar David Friedrich, Goethe und die Romantik in Weimar, hg. v. Annette Ludwig, Christoph Orth, Katharina Krügel, Johannes Grave, Johannes Rößler. Berlin: Hatje Cantz 2024, Museumspreis 29,90 €, Buchhandelspreis 40 €
Rund 20 Objekte der Ausstellung sind in der CDF_Chronik_Webportal recherchierbar.
Bild: Caspar David Friedrich, Hühnengrab am Meer, 1806/1807. © Klassik Stiftung Weimar, Museen

9. Biennale Buchkunst Weimar
7. und 8. Dezember 2024, jeweils ab 10 Uhr
9. Biennale Buchkunst Weimar
congress centrum weimarhalle (Seminargebäude),
UNESCO-Platz 1, 99423 Weimar
Ein Fest für alle Sinne! Einzigartige Unikate, seltene Kleinstauflagen oder prachtvolle Vorzugsausgaben verführen zum Blättern. Die von Gudrun Illert (Atelier G) zum 9. Mal veranstaltete Biennale Buchkunst Weimar bringt beeindruckende Werke von 46 renommierten Künstlerinnen und Künstlern zusammen und zeigt die besondere Bedeutung von Künstlerbüchern im digitalen Zeitalter.
Experimentierfreude und Ausdrucksstärke offenbaren auch die zur Anwendung kommenden grafischen Techniken, von Photogrammen und Aquatinta über Holzschnitte, Zeichnungen und Malerbücher bis hin zu Mappenwerken und Lithografien.
Eröffnet wird die Messe am 6. Dezember um 18 Uhr von Dr. Annette Ludwig, Direktorin der Museen der Klassik Stiftung Weimar.
Parallel zur Buchkunst-Biennale stellt Stefan Knechtel unter dem Titel Schattengang grafische Arbeiten in der Galerie Profil Weimar (Geleitstraße 11) aus. Der 1964 in Dessau geborene Künstler lebt und arbeitet in Kürbitz bei Altenburg. Zur Ausstellungseröffnung am 20. November um 18 Uhr spricht Dr. Benjamin Rux, Kustos am Lindenau-Museum Altenburg.
Faltblatt mit allen Informationen: _Biennale_Buchkunst_9 Weimar2024
Bild © Christian Ewald (Katzengrabenpresse), Blick zum Himmel, Unikat, 2021
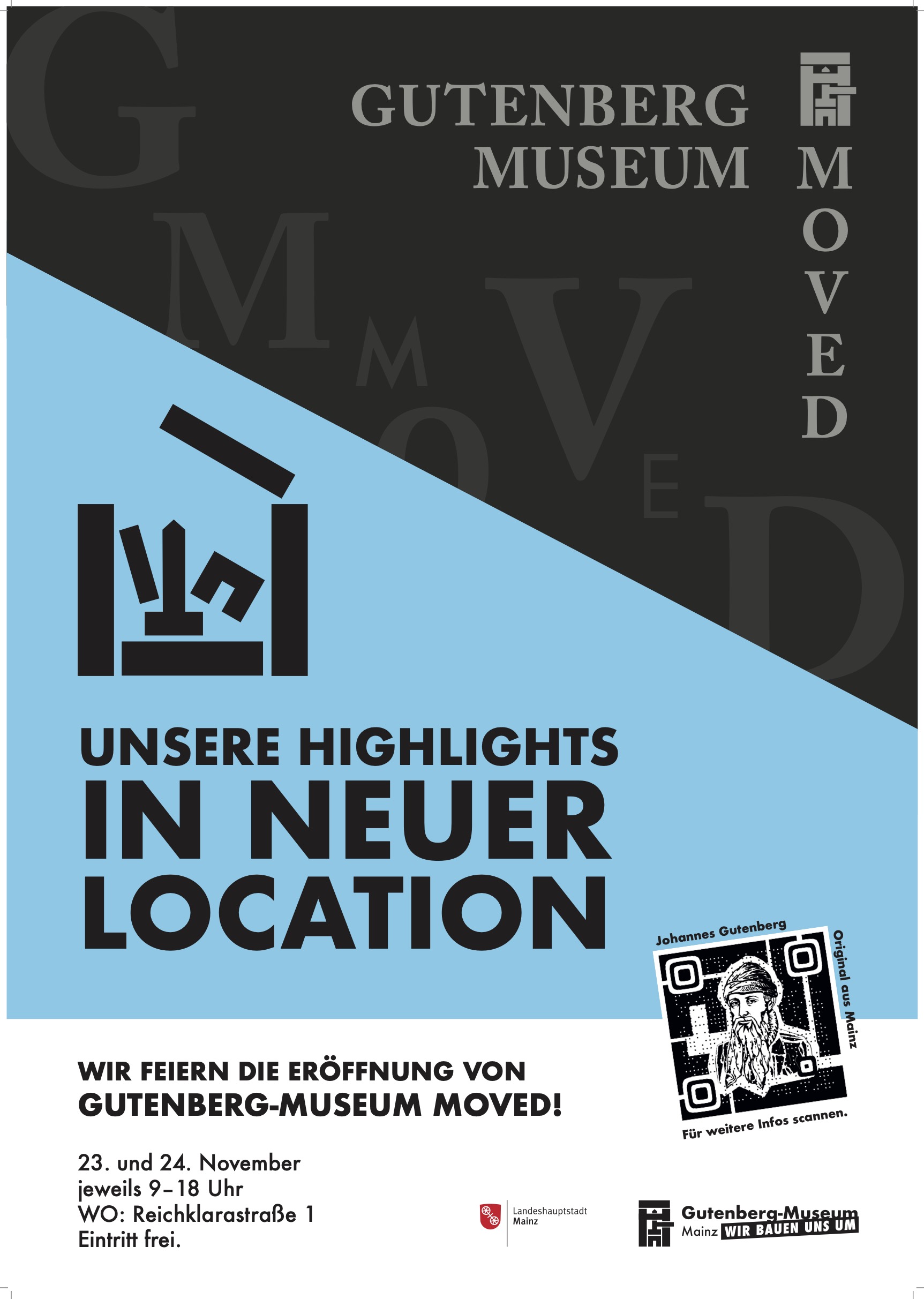
«Gutenberg-Museum MOVED»
23. und 24. November 2024, jeweils 9 bis 18 Uhr
Freier Eintritt am Eröffnungswochenende
Naturhistorisches Museum Mainz
Reichsklarastraße 1, 55116 Mainz
Nach intensiver Vorbereitung wird die neu kuratierte Ausstellung am Interimsstandort des Gutenberg-Museums im Naturhistorischen Museum Mainz am morgigen Freitag feierlich eröffnet.
Am Eröffnungswochenende von «Gutenberg-Museum MOVED» gilt am 23. und 24. November kostenfreier Eintritt. Es werden Kurzführungen der Kuratorinnen, Druckvorführungen sowie ein museumspädagogisches Druckangebot im Druckladen angeboten. Ebenso haben die Gäste die Möglichkeit den Gutenberg-Shop der Gutenberg Stiftung mit Café im Museumspavillon zu den Öffnungszeiten des Museums zu besuchen. Für die Kurzführungen der Kuratorinnen ist keine Anmeldung erforderlich.
Plakat zur Eröffnung von «Gutenberg-Museum MOVED»

Der «Grüffelo» wird versteigert …
Donnerstag, 28. November 2024, 19 Uhr
Benefiz-Auktion der Internationalen Jugendbibliothek
Schloss Blutenburg, Seldweg 15, 81247 München
Namhafte Illustrationskünstler wie Rotraut Susanne Berner (Die Wimmelbücher; Karlchen), Erhard Dietl (Die Olchis), Daniela Kulot, Axel Scheffler (Der Grüffelo) und Susanne Straßer (Nachts im Wald) haben auf Einladung des Freundeskreises der Stiftung Internationale Jugendbibliothek Originale für die Auktion gestiftet. Hinzu kommen Exponate aus dem Nachlass von Binette Schroeder.
Die Auktion wird der Münchner Alt-Oberbürgermeister Christian Ude moderieren. Einige der bekannten Künstlerinnen und Künstler werden an dem Abend anwesend sein. Der Erlös kommt der Förderung der Kinderbuchillustration durch Ausstellungen und Workshops in der Internationalen Jugendbibliothek zugute.
Verbindliche Anmeldung via eMail erbeten unter anmeldung@ijb.de.
Externe Bieter kontaktieren bitte: direktion@ijb.de
Auktionskatalog zum Download: Auktionskatalog_Benefiz_ijb
Bild © Internationale Jugendbibliothek, Axel Scheffler

Halle (Saale) feiert die «Archivophilie»
21. November 2024 bis 27. April 2025
Archivophilie. Schönes aus dem Archiv der Franckeschen Stiftungen
Kabinettausstellung
Historische Bibliothek, Haus 22–24, Franckeplatz 1, 06110 Halle
Di bis So 10 bis 17 Uhr
Eröffnung am 20. November, 18 Uhr
mit Vortrag von Frau Prof. Dr. Ulrike Höroldt,
Direktorin des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz Berlin
Ort: Englischer Saal, Haus 26
anschließend Führung durch die Ausstellung
Eintritt frei
Das Archiv der Franckeschen Stiftungen beherbergt eine Fülle an historischen Schätzen, die nicht nur einen kulturellen und historischen, sondern auch einen ästhetischen Wert besitzen. Darunter sind orientalische und mittelalterliche Handschriften mit kunstvollen Kalligrafien und filigranen Illustrationen, Urkunden mit feinen Schriftzügen auf wertvollem Pergamentpapier, Einbände aus Buntpapier und Planzeichnungen mit präzisen Linien und schöner Farbigkeit – die präsentierten Exponate vermitteln einen Eindruck vergangener Handwerksmeisterschaft.
Abbildung: Stadtansicht von Halle (Saale) aus dem Stammbuch des Studenten Immanuel Petrus Geier, 1719–1722. AFSt/H D 133
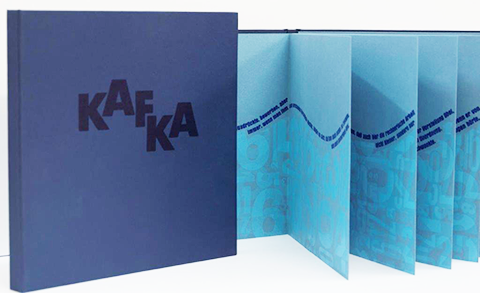
Buchkunsttage München
15. bis 17. November 2024
Buchkunsttage München
Lyrik Kabinett, Amalienstraße 83a, 80799 München
Freitag: 18 bis 21 Uhr
Samstag: 12 bis 18 Uhr
Sonntag: 12 bis 17 Uhr
Die Ausstellung zeitgenössischer Buchkunst im Lyrik Kabinett München fand erstmals 2008 und von da an alle zwei Jahre statt, bis zur pandemiebedingten Unterbrechung. Unter dem neuen Namen buchkunsttage – Neue Buchkunst & Druckgrafik im Lyrik Kabinett gibt es die Buchkunstausstellung Mitte November 2024 nun zum siebten Mal.
17 Buchkünstler:innen, deren Arbeitsweise kaum unterschiedlicher sein könnte, zeigen ihre Werke an 14 Ausstellungsplätzen und präsentieren eine große gestalterische Vielfalt. Neben Büchern gibt es Mappenwerke, grafische Einzelblätter, Papierobjekte, Originaldrucke im Postkartenformat und noch viel mehr Gedrucktes.
Mehr Informationen: 2024_buchkunsttage_münchen
Bild © Christa Schwarztrauber, Handsatzwerkstatt Fliegenkopf: Franz Kafka, Poseidon, Auflage: 50 Exemplare

Buch- und Druckkunst-Messe in Frauenfeld
15. bis 17. November 2024
Buch- und Druckkunst-Messe
Eisenwerk in Frauenfeld, Kanton Thurgau, Schweiz
Freitag und Samstag: 11 bis 18.30 Uhr
samstags ab 18 Uhr Apéro und Musik
Sonntag: 11 bis 16 Uhr
Die Buch- und Druckkunst-Messe, auch bekannt als Handpressenmesse HPM, findet in diesem Jahr zum 16. Mal im Frauenfelder Eisenwerk statt. Ausstellende aus der Schweiz und internationale Gäste präsentieren ein breites Spektrum kunstvoller Papierwerke, von der handgefertigten Postkarte über Plakate, Büttenpapiere, Notizbücher bis hin zum einzigartigen Künstlerbuch.
Ehrengast ist diesmal der vielfach preisgekrönte Grafikdesigner und Buchdrucker Dafi Kühne. In seiner Werkstatt in Näfels verbindet er die digitalen Techniken kreativ mit dem Buchdruckverfahren.
Einblicke gibt es hier: Dafi_Kühne_babyinktwice
Gegründet wurde die HPM vor dreißig Jahren von dem Schriftsteller, Verleger, Druckkünstler und gelernten Schriftsetzer Beat Brechbühl.
Mehr Informationen: 2024_HPM_Frauenfeld
Impressionen der HPM 2022. Foto: HPM
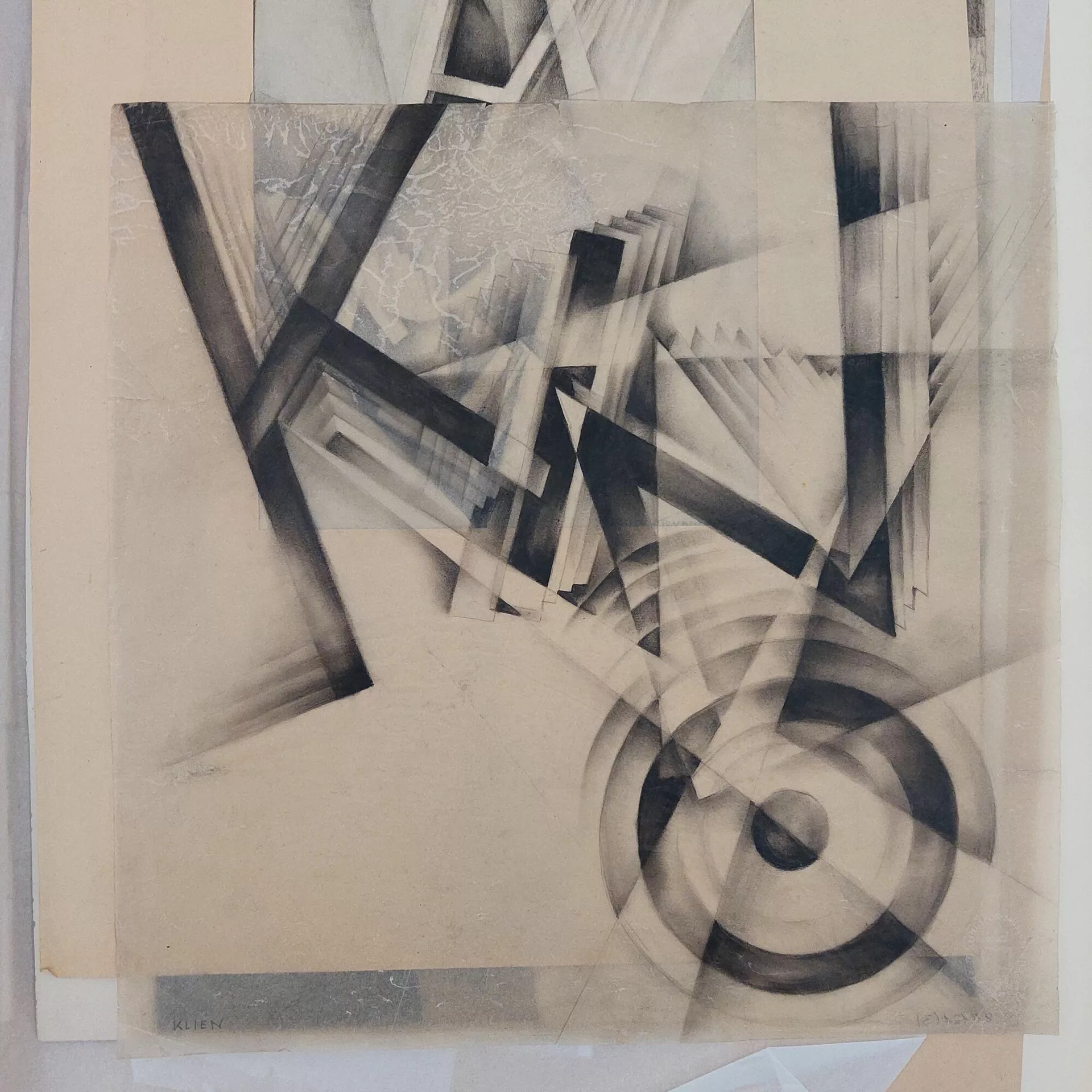
Klingspor Museum: Same Bold Stories?
bis 24. November 2024
Same Bold Stories?
Schriftgestaltung von Frauen und Queers im 20. und 21. Jahrhundert
Klingspor Museum, Herrnstraße 80, 63065 Offenbach
Das Museumsteam machte es sich zur Aufgabe, die historische schriftbezogene Sammlung des Klingspor Museums (1900–1950) nach weiblichen Positionen zu durchforschen und die Geschichtsschreibung der Schriftgestaltung um ihre Biografien und Werke zu ergänzen. Nur wenige Frauen wie Anna Simons, Erika Giovanna Klien oder Gudrun Zapf-von Hesse erlangten bereits zu Lebzeiten größere Bekanntheit. Daneben gibt es Schriftgestalterinnen wie Elizabeth Friedländer, Ilse Schüle, Anna Maria Schildbach, Maria Ballé und zahlreiche Schülerinnen, etwa der Schriftklassen Rudolf von Larischs in Wien und Rudolf Kochs in Offenbach, die in der Sammlung enthalten sind und nun erstmals in den Fokus rücken.
Von der historischen Sammlung ausgehend wird der Bogen geschlagen zum Typedesign der Gegenwart – von Personen, die sich als FLINTA* (Frauen, Lesben, Inter*, nichtbinär, Trans* und Agender) identifizieren. Selbstbewusst und innovativ gestalten sie nicht nur Schriften, sondern auch die internationale Schriftszene mit. Ideen von kollektivem Arbeiten finden hier Anwendung und solidarische Distributionswege stehen neben klassischen Vertrieben in Type Foundries. Häufig verwischt dabei die Grenze zwischen Anwendung und Kunst, sodass spannende inhaltliche Konzepte ein neues Nachdenken über Typedesign und Typografie im 21. Jahrhundert anstoßen. Émilie Aurat, Jin-Hoo Park, Golnar Kat Rahmani und Nat Pyper sind nur einige der zahlreichen Namen, die in der Ausstellung vereint und in Kontext zueinander gesetzt werden.
Im November finden diese Veranstaltungen statt:
2.11, 14–17 Uhr
Let’s Talk About Money. Verhandlungsworkshop für FLINTA*
Anja Henningsmeyer
mit Anmeldung, solidarischer Teilnahmebeitrag, Richtwert 20 Euro
3.11., 16 Uhr
Significant Other(ing) – Messy History als feministisches Gegenkonzept der Kunst- und Designhistoriografie
Vortrag Naomi Rado
Eintritt + 1,50 Euro
9.11., 11–16 Uhr
Type & Politics
Vortrag und Siebdruck-Workshop mit Golnar Kat Rahmani in der Druckwerkstatt im Bernardbau
mit Anmeldung, 30 Euro Teilnahme + 15 Euro Material
22.11., ab 18 Uhr
Eat It by the Creek – Performativer Abend mit Drag
Eintritt nach Wahl
24.11., 15 Uhr
Finissage mit Kurator:innenführung
Dr. Dorothee Ader, Laura Brunner, Naomi Rado
Eintritt frei
Abbildung: Erika Giovanna Klien, Kino, Schriftarbeit aus dem Bereich der kinetischen Kunst, Bleistift und Kohlestift auf Papier 1923. Foto © Simon Malz
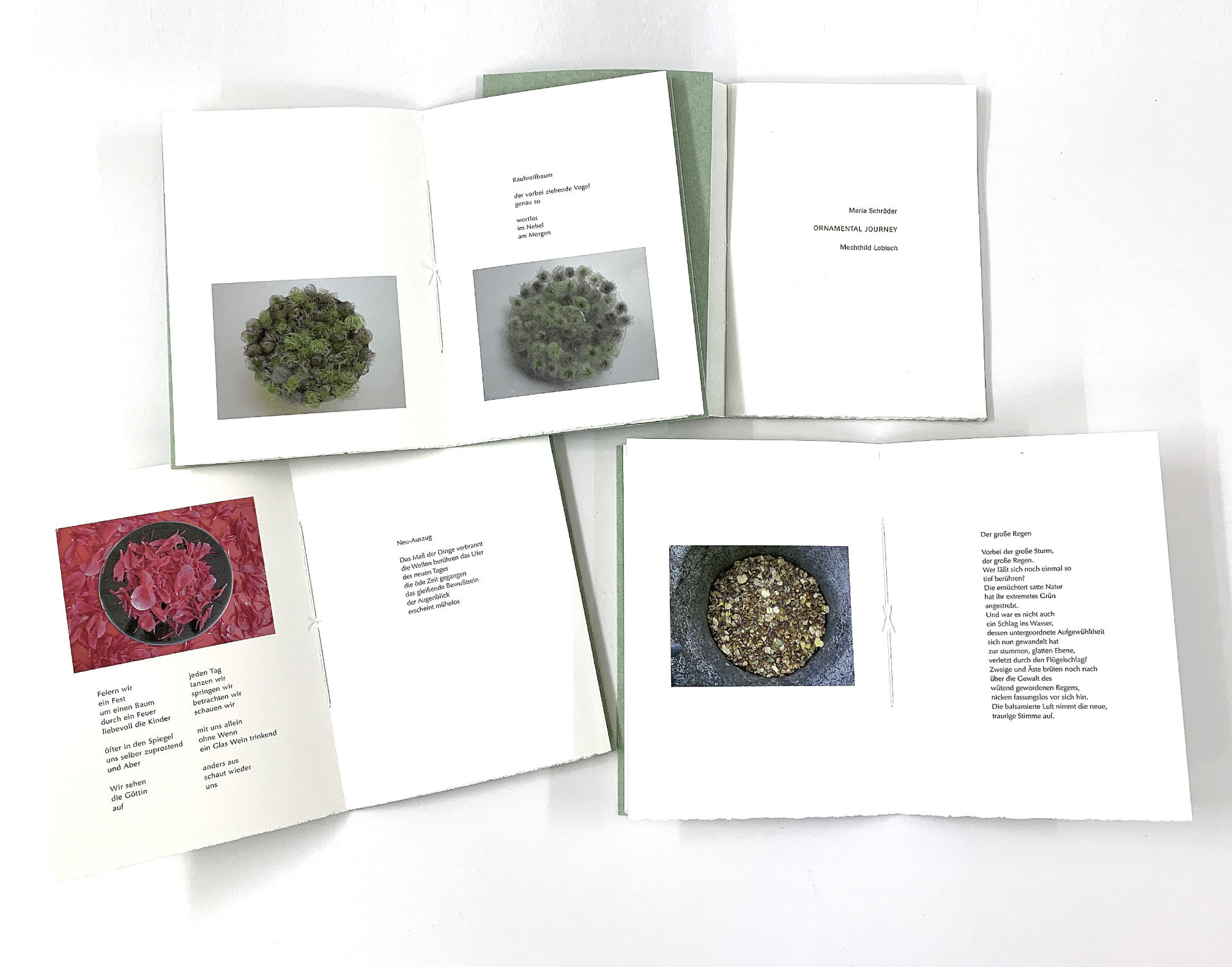
Mechthild Lobisch – Espaces Meublés
bis 31. Januar 2025
Mechthild Lobisch – Espaces Meublés
Praxis Rüdiger Buresch
Bahnhofstraße 2, Gauting
Mechthild Lobischs Leidenschaft gilt einerseits der Sprache und der Literatur, andererseits dem Bild und dem Buch.
Die als Buchbinderin ausgebildete vielseitige Künstlerin, Fachautorin und Übersetzerin lehrte von 1995 bis 2006 als Professorin der Klasse Konzeptkunst Buch an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule. Seither ist sie in Gauting als freischaffende Künstlerin tätig.
Den gezeigten Arbeiten gemeinsam sind klare, formale Ordnungen eines geometrisch angelegten Vokabulars. Überlagerungen und Fragmentierungen bilden Strukturen, die sich zum Teil auch Fotomontagen anverwandeln. Bei aller Strenge ein lustvolles Spiel mit Symmetrien, Asymmetrien und Trompe-l’œils.
Bild:
Künstlerbuch Ornamental Journey, vier jahreszeitliche Hefte in je vier Exemplaren mit Gedichten von Maria Schröder und Fotografien von Mechthild Lobisch. © Mechthild Lobisch